Interview: Pablo Larraín über »Maria«
Pablo Larraín
Pablo Larraín, 1976 in Santiago, Chile geboren, wurde international 2008 bekannt, als sein Film »Tony Ramero« im Rahmen der Quinzaine des réalisateurs in Cannes gezeigt wurde. Mit »Post Mortem« (2010) und »No!« (2012) vervollständigte er eine Trilogie über Chile unter dem Pinochet-Regime, die er mit Filmen wie »Neruda« (2016) und »El Conde« (2023) ergänzte. Mit »Jackie« (2016), »Spencer« (2021) und jetzt »Maria« gibt es eine neue Trilogie
Herr Larraín, Sie kamen schon früh mit Oper in Berührung . . .
Pablo Larraín: Meine Mutter nahm mich bereits mit acht mit ins Opernhaus hier in Santiago. An einzelne Inszenierungen kann ich mich nicht erinnern, mich hat vor allem die Idee fasziniert, eine Geschichte mit den Mitteln der Musik zu erzählen. Darüber wurde auch mein Interesse am Kino geweckt.
Wie schwierig war es, eine Perspektive auf eine Ikone wie Maria Callas zu finden, von der wir so viel zu wissen glauben?
Das tun wir ja gar nicht. Ich habe so ziemlich alles gelesen, was sie je gesagt hat. Ich habe mir jedes Interview angesehen, höre ihre Musik seit 40 Jahren. Und ich bin mir noch immer nicht sicher, wer sie war. Sie ist ein Mysterium, das man nie vollständig begreift. Das ist auch gut so. Es gab mir die Möglichkeit, mit ihrem Geheimnis zu arbeiten.
Sie beginnen mit ihrem Tod, imaginieren dann die letzte Woche ihres Lebens. Warum dieser Fokus?
Weil ich dadurch zeigen kann, dass sie am Ende ihres Lebens erst zu der wurde, die sie immer sein wollte. Sie hat nicht mehr für die anderen gesungen, sie hatte keine Beziehung, um die sie sich kümmern musste. Sie hat einfach ihre eigene Stimme gefunden, um ganz für sich selbst singen zu können. Das war ein großer Schritt für sie.
Aber es ist eine Interpretation . . .
Wir hatten viele Informationen, wie die Wohnung aussah, wer in der Wohnung war, was sie aß. Aber man weiß nicht wirklich, was dort passiert ist. Je weniger man weiß, desto mehr kann man tun. Es wird zu einem Akt der Fiktion.
Diesen Ansatz hatten Sie bereits in »Jackie« und »Spencer«, auch in »El Conde«, in denen Sie Realismus und Spekulation verweben. Wie sind Sie die Gratwanderung hier angegangen?
Im Fall von Maria gibt es etwas zwischen ihr als Mensch und uns: die Musik. Sie war eine der größten Sängerinnen der Geschichte. Und das hat sie mit viel Technik, Training und Disziplin geschafft, aber auch durch ihre Wut und ihre Emotionen auf der Bühne. Sie hat oft eine Anekdote erzählt: dass sie sich bei einer Aufführung mal auf der Bühne verirrt habe. Und der italienische Dirigent Tullio Serafin, ihr Entdecker und Lehrmeister, gab ihr den Rat, nur der Musik zu folgen, denn darin sei bestimmt, was mit ihr und ihrer Figur passiert. Ich glaube, darin steckt etwas, das auch mit Marias Leben zu tun hat. In der Musik liegt der Schlüssel zum Verständnis der Callas. Sie hatte die unbedingte Notwendigkeit, als Sängerin gehört zu werden.
Sie finden in Ihren Filmen immer eine spezifische Ästhetik, die eng mit der Geschichte und den Figuren verbunden ist. Wie haben Sie sie bei »Maria« entwickelt?
Sie war in jeder Hinsicht eine Opernfigur. Wir haben also versucht, alles so zu filmen, als wären wir auf einer Bühne. Wir erleben die Welt mit ihr und durch ihre Musik. Auch ihre Wahrnehmung, wenn sie etwas sieht, das nicht real ist, das nur in ihrer Vorstellung passiert. Wir teilen ihre subjektive Beziehung zur Realität.
Die Besetzung mit Angelina Jolie ergibt eine faszinierende Überblendung zweier Starimages, die sich gegenseitig aufladen. Warum Jolie?
Zunächst weil auch Angelina etwas Rätselhaftes hat. Wir glauben, viel über sie zu wissen, aber sie bleibt ein Mysterium. Das war auch mein Ansatz bei den beiden anderen Teilen der Trilogie, »Jackie« mit Natalie Portman und »Spencer« mit Kristen Stewart. Sie alle tragen etwas in sich und zugleich können sie eine Ikone spielen. Weil sie es verstehen. Bei Angelina geht es vor allem darum, was sie vor uns verbergen kann. Man sieht sie an und denkt, da ist noch etwas anderes. Aber man weiß nicht, was es ist. Die Zuschauer müssen sich selbst einen Reim darauf machen. Ich möchte nicht für ein Publikum arbeiten, das all die Ideen, die im Film vorkommen, nur passiv aufnimmt.
Wie haben Sie mit Angelina Jolie gearbeitet, insbesondere mit der Stimme?
Angelina hat sehr schnell verstanden, dass man in der Oper nicht mogeln kann. Man kann nicht so tun, als ob man singen würde. Man muss es tun. Es war also eine sehr lange Probenzeit erforderlich. Sie hat sieben Monate lang trainiert und gelernt, wie man atmet, wie man geht, und dann hat sie jedes Musikstück geübt. Sie singt tatsächlich im Film, ihre Stimme vermischt sich mit der von Callas, um es so glaubwürdig wie möglich wirken zu lassen.
»Maria« ist eine deutsche Koproduktion mit Komplizenfilm, Maren Ade ist eine der Produzentinnen. Wie ist diese Zusammenarbeit entstanden?
Wir sind seit vielen Jahren befreundet und haben eine Reihe von Filmen zusammen produziert. Ich vertraue ihrem Geschmack, ihren Ideen. Es ist eine gute Partnerschaft, und ich hoffe wirklich, dass wir das weiterhin tun können.

.jpg)

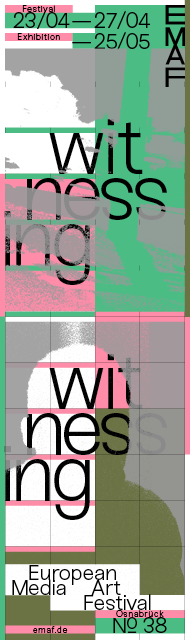

Ihre Meinung ist gefragt, Schreiben Sie uns