International Film Festival Rotterdam 2025
Im Haus meiner Eltern (2025)
»Lasst die Bösen nicht gewinnen!« Gleich drei Regisseure und Regisseurinnen endeten ihre Dankesrede bei der Preisverleihung der 54. Ausgabe des Rotterdamer Filmfestivals mit diesem kämpferischen, aber auch irgendwie hilflosen Ausruf. Das jeher politisch engagierte Festival stand natürlich im Schatten der aktuellen globalen Krisen, Konflikte und reaktionären politischen Bewegungen. Umso erfreulicher war es daher, dass der Hauptpreis an ein dezidiert anti-faschistisches und dabei noch erstaunlich unterhaltsames Filmexperiment ging.
Trotz strahlenden Sonnenscheins im Februar waren die Kinosäle oft bis auf den letzten Platz gefüllt. Dank erschwinglicher Ticketpreise und gut erreichbarer Lokationen erwies sich das zum fünften Mal von Vanja Kaludjeric geleitete Event in diesem Jahr erneut als ein echtes Publikumsfestival, ohne dabei vom oft anspruchsvoll kuratierten Programm abzuweichen. Besonders im Herzstück des Festivals, dem Tiger-Wettbewerb für junge FilmemacherInnen, zeigte sich die gewohnte Rotterdamer Mischung aus Experimentierfreude und Zugänglichkeit sowie der lobenswerte Mut zur Diversität: Spielfilme, Animationen, Dokus und unkategorisierbare Mischformen aus allen Teilen der Welt konkurrierten um den Goldenen Tiger, wenn der Wettbewerbsschwerpunkt in diesem Jahr auch auf Filmen aus Ost- und Mitteleuropa zu liegen schien.
Ein verbindendes Thema in dieser stilistischen und kulturellen Vielfalt des Wettbewerbs war, das Große im Kleinen zu suchen. Das zeigte sich teils in Familienkonflikten, die in mehreren Fällen explizit den Leben der FilmemacherInnen entstammten, teils in detaillierten Erkundungen von Dörfern, Städten oder in einem Fall gar einem einzelnen Baum im kongolesischen Dschungel. Zur Kategorie der intimen Familienaufstellung kann man den deutschen Beitrag »Im Haus meiner Eltern« von Tim Ellrich zählen, ein grandios gespieltes, klaustrophobisches Familiendrama, das in präzisen Schwarz-Weiß-Bildern Ellrichs Erfahrungen mit einem an Schizophrenie erkrankten Familienmitglied fiktionalisiert. Jenny Schily begeistert in der Hauptrolle einer esoterischen Geistheilerin, die sich um die Betreuung ihres Bruders kümmern muss. Nicht unähnlich thematisierte der serbische Film »Wind, Talk To Me« einen drastischen Einschnitt im Leben des Regisseurs Stefan Djordjevic. Im meditativen Tempo und mit sommerlichen Bildern erzählt der bewegende Film von der Trauerarbeit einer Familie, deren Mitglieder allesamt von Djordjevics Verwandten gespielt werden.
Der österreichische Film »Perla« hingegen verarbeitet persönliche Erfahrungen von Flucht und Migration: Regisseurin und Autorin Alexandra Makarová erzählt dort von einer begabten Malerin (Rebeka Poláková) in Wien – lose auf ihrer Mutter basierend – die Jahre nach ihrer Flucht aus der kommunistischen Tschechoslowakei von ihrem Ex-Partner überzeugt wird, in die nun fremde Heimat zurückzukehren. Zwar driftet der Film gegen Ende in allzu melodramatische Gefilde ab, doch das brillante Ensemble überzeugt durchweg.
Der Essayfilm »L'arbre de l'authenticité« aus der Republik Kongo gewann für seine innovative Aufarbeitung der Kolonialgeschichte und der ökologischen Bedeutung des Landes den zweiten Preis. Der Film stützt sich auf Forschungsergebnisse aus den 1930er Jahren und beleuchtet die entscheidende Rolle des Kongobeckens bei der Aufnahme von Kohlendioxid und der Gestaltung des globalen Umweltgleichgewichts über ein Jahrhundert hinweg. Nach dem die ersten zwei Kapitel historische Charaktere zu Wort kommen lassen, spricht im letzten Drittel gar ein Baum zum Publikum.
Den Hauptpreis des Festivals gewann hochverdient der Kroate Igor Bezinović für sein mitreißendes Doku-Experiment »Fiume O Morte!«. Der Film ist ganz auf die Küstenstadt Rijeka und ihre bewegte Geschichte fokussiert, genauer gesagt auf eine kurze Episode zu Beginn des 20. Jahrhunderts als die Stadt von einem abtrünnigen italienischen Faschisten, Gabriele D'Annunzio, unterworfen wurde. Doch statt dröger Dokumentarfilm-Tropen setzt Bezinović auf eine inspirierte Mischung aus Archivmaterial und nachgespielten Szenen, für die er normale Bürger Rijekas einspannt. So entsteht ein lebendiges Porträt einer Stadt, das trotz reichlich trockenem Humor und grandioser Musik eine ernste Warnung vor sich formierendem Autoritarismus darstellt. Wenn wir nicht aufpassen, gewinnen die Bösen eben doch.

.jpg)

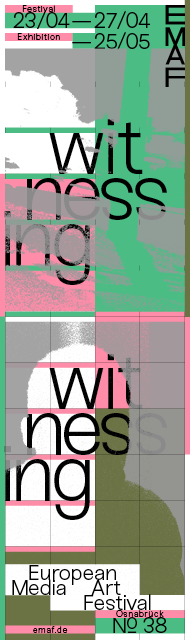

Ihre Meinung ist gefragt, Schreiben Sie uns