Kritik zu Warfare
Alex Garland rekonstruiert mit minuziöser Genauigkeit einen Vorfall aus dem Irakkrieg: Ein Platoon von Navy Seals geriet in der Stadt Ramadi in schwere Bedrängnis und musste gerettet werden
In »Warfare« verdichten Alex Garland und Ray Mendoza das Wesen des Krieges in einer etwa anderthalbstündigen Aktion, die am 19. November 2006 während des Irakkrieges in der Stadt Ramadi durchgeführt wurde. Ray Mendoza war an dieser Aktion beteiligt, auf seinen Erinnerungen sowie jenen seiner Kameraden basiert das Drehbuch, das Garland und Mendoza gemeinsam schrieben. Sie führten auch gemeinsam Regie. Bei Garlands letztjährigem Film »Civil War« fungierte Mendoza als militärischer Berater. Und in der Unmittelbarkeit der Gewalteinwirkung – auf Figuren wie auf das Publikum – erinnert »Warfare« immer wieder an »Civil War«. Es ist, als wären die beiden Geschwisterfilme. Oder als wäre »Warfare« das eine ikonische Foto, von dem die ausgebrannte Kriegsfotografin Lee Smith in »Civil War« spricht; jenes Foto, das den Menschen zu Hause die Mahnung bringt: »Don't do this.« – »Macht das nicht. Lasst es.«
»Warfare« zu sehen ist strapaziös. Der Film schlägt keinen großen Bogen, entwirft keinen Rahmen, wertet nichts. Er hält sich an das zentrale Ereignis jenes Tages, wie es sich in die Köpfe der Beteiligten gegraben hat: Ein Platoon Navy Seals besetzt ein Wohnhaus und installiert einen Scharfschützen als bewehrten Beobachtungsposten. Feindliche Kämpfer werden aufmerksam und organisieren Beschuss. Ein Getroffener soll evakuiert werden, bei welcher Gelegenheit das gesamte Platoon ins Visier gerät und mit nunmehr mehreren Verwundeten im Haus festsitzt. Alsdann bemüht man sich um Rettung. Zu den am Geschehen Teilnehmenden gehört auch die Luftraumüberwachung, deren Perspektive immer wieder abstrahierend in die aus Blutgesudel, Schmerzgeschrei und Hilfsbemühungen zusammengesetzte Atmosphäre im Haus hineingrätscht. Dann werden in bürokratischem Tonfall die Vorgänge auf den Straßen beschrieben, während aus einiger Höhe die Bewegungen weißer Gebilde verfolgt werden, von denen immer mal wieder eines umfällt und liegen bleibt. Auch die Frage, was die wiederholt eingeforderte »show of force« ist, wird umfassend geklärt. Dann fliegen im Kino die Lautsprecher schier von den Wänden. Wie im Übrigen »Warfare« mit einem gefinkelten Sounddesign aufwartet, das der Beunruhigung der Zuschauer*innen zuarbeitet. Mit seiner Hilfe wird das Kino zum Ort, an dem der Krieg uns die Orientierung nimmt.
Und nicht nur in dieser Hinsicht wird die Dringlichkeit, die Garland und Mendoza antreibt, förmlich körperlich spürbar. Möglichst nahe wollen die beiden heran an die Wahrheit des Krieges – die sie jenseits von Kameradschaft und Heldentum, Strategie und Taktik, wirtschaftlichen Manövern oder geopolitischen Interessen verorten: in der Arbeit von Profis, die nicht selten der Arbeit in einem Schlachthaus gleichkommt.
Neu ist das nicht. Es ist aber zum einen als ehrlicher Versuch einer authentischen Schilderung und zum anderen in seiner nüchternen Reduktion auf inhärente Grausamkeit doch besonders bedrückend. Und wenn der Lärm versiegt und der Nebel sich lichtet, hören wir Lee Smith, die sagt: »Macht das nicht. Lasst es.« Denn die Hoffnung stirbt zuletzt.

.jpg)

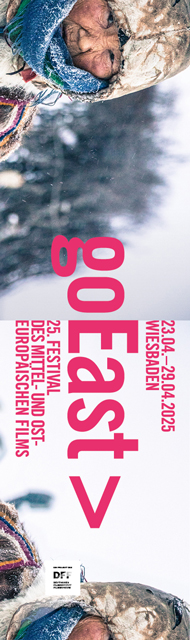
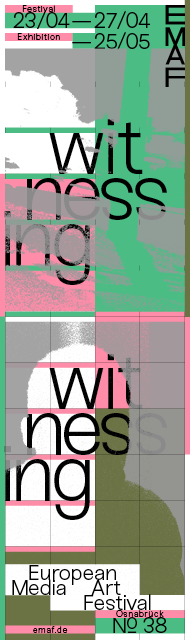

Ihre Meinung ist gefragt, Schreiben Sie uns