Kritik zu Sisterqueens
In ihrem Dokumentarfilm begleitet Clara Stella Hüneke drei Mädchen, die als Rapperinnen und junge Frauen in einem sozialpädagogischen Zentrum in Berlin Unterstützung finden
Jamila, Rachel und Faseeha sind Freundinnen und engagieren sich beim interkulturellen Mädchenprojekt »Mädea« im Berliner Wedding. Dort werden sie von Sozialarbeiterinnen und gestandenen Rapperinnen wie Fatou »Sister Fa« oder »Haszcara« beim Aufbau ihrer eigenen Rap-Truppe »Sisterqueens« unterstützt. Bei allen Unterschieden der Mädchen (etwa Berufswünsche von »Gangsta« bis Wissenschaftlerin) ist ihnen gemeinsam der leidenschaftliche und idealistische Einsatz für die Selbstermächtigung von jungen Frauen, für Akzeptanz und gegen den alltäglichen Rassismus: »... leiten uns nicht von Gier, Erstreben nur nach Freiheit«, heißt es programmatisch in einem ihrer Songs, die auch sonst gerne frech die deutsche Grammatik poetisch erweitern.
Rappende Frauen sind seit ein paar Jahren real und medial vermehrt sichtbar als Gegengift zum großkotzigen Männertum, Porträts großstädtischer Mädchencliquen im deutschen Dokumentarfilm seit dem Erfolg von Bettina Blümners »Prinzessinnenbad« 2006 fast schon zum Subgenre avanciert. »Sisterqueens« (eine Produktion des kleinen Fernsehspiels), der seine Heldinnen vier Jahre bis zu einem umjubelten Auftritt im Berliner Theater Hebbel am Ufer (HAU) begleitet, verbindet beides und ist letztes Jahr erfolgreich auf vielen Filmfestivals gelaufen.
Doch die eigentliche dramaturgische Spannung des Films zielt eher auf den Gewinn emotionaler Selbsterkenntnis. Dabei ist die bewegte Kamera nah an den Heldinnen in ihrem Heimatkiez und bei Ausflügen in die Welt drumherum, wo sie sich nicht immer willkommen fühlen. Bei einem Besuch im Naturkundemuseum etwa werden die wissbegierigen Mädchen wegen einer unter dem Kopftuch verrutschten Maske von einem Aufseher angeblafft und mit Hausverweis bedroht.
Eher am Rande sichtbar wird in dem Abschlussfilm an der Ludwigsburger Filmakademie auch das familiäre Umfeld mit Geschwistern und Müttern (Väter kommen nur als Abwesende vor), deren tatkräftige und emotionale Unterstützung von den Töchtern in einem eigenen Song gewürdigt wird. Filmisch zeigen diese familiären Szenen auch eine deutliche Gelassenheit im fast beiläufigen Anriss schwieriger Lebens- und Bildungsverläufe der Mädchen oder ihrer aktuellen Konflikte. Dass auch die (leider wohl selbstverständlichen) Anfeindungen gegenüber dem Projekt von außen im Film selbst keinen Platz finden, darf wohl als bewusste Gewichtung der Regisseurin auf das Motiv gelingender weiblicher Selbstermächtigung verstanden werden.
Denn der Film zeigt sehr schön und deutlich, dass auch zehnjährige Mädchen nicht formbare Masse, sondern Subjekte mit eigenen Ansprüchen und Fragen an das Leben sind: Was sie brauchen, sind Orte für sich selbst, emotionale Unterstützung, technischen Support und ab und zu einen lebenspraktischen Kick. Wie sagt »Old School«-Rapperin Fatou zu Rachel: »The best way to realize your dreams? Wake up!« – Um die eigenen Träume wahr zu machen, muss man aufwachen.

.jpg)

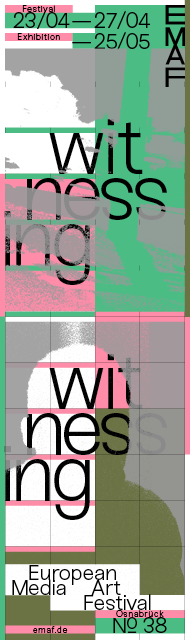

Ihre Meinung ist gefragt, Schreiben Sie uns