Berlinale: Eine notwendige Zumutung
Vor genau fünf Jahren, am 19. Februar 2020, erschoss ein rechtsextremer Terrorist in Hanau neun junge Menschen in Bars. Den Hinterbliebenen und ihrem Kampf um Anerkennung und Aufarbeitung widmet sich die Dokumentation »Das Deutsche Volk« (Kinostart: Herbst 2025) von Marcin Wierzchowski, der in der Sektion »Berlinale Special« seine Premiere feierte. Über vier Jahre begleitete der Regisseur die Familien der Ermordeten, vor allem die Eltern des getöteten Hamza Kurtović, den Bruder des ermordeten Gökhan Gültekin, die Mutter von Sedat Gürbüz und den Vater von Vili Viorel Păun. In seiner 132 Minuten langen, in Schwarz-Weiß gedrehten, unkommentierten Dokumentation lässt er der Wut und Trauer der Angehörigen, aber auch ihrem unermüdlichen Engagement gegen das Vergessen viel Raum. Das ist zuweilen im besten Sinne eine emotionale Zumutung, etwa wenn die Familien erzählen, wie sie in den Stunden nach dem rassistischen Attentat versucht haben, ihre Kinder zu erreichen und erst erfahren, was geschehen ist, als ein Polizist eine Liste der Opfer mit den Worten einleitet: »Und jetzt diejenigen, die es nicht geschafft haben«. Die Dokumentation zeigt, wie die Eltern sich an ihrer Trauer abarbeiten, die Handys ihrer Kinder weiterhin täglich aufladen, an ihren Schuhen riechen oder die blutige Kleidung aufbewahren. Man beobachtet mit zunehmendem Erstaunen die Hilflosigkeit der deutschen Behörden, einen empathischen Umgang mit den Hinterbliebenen zu finden und eine transparente Aufklärung voranzutreiben. Es irritiert, wenn die Fragen der Angehörigen (Warum war der Notausgang der Bar verschlossen, in der der Attentäter anfing zu schießen? Wieso hatte ein psychisch auffälliger Täter noch einen Waffenschein? Warum lagen die Leichen der Opfer teilweise 20 Stunden am Tatort?) mit ungefilterter emotionaler Wucht an überforderten Mandatsträgern abprallen, die sich nicht anders zu helfen wissen, als sich hinter Phrasen und Beschwichtigungen zu verschanzen. Die Doku kulminiert in der Debatte, wo das Denkmal für die Opfer in Hanau aufgestellt werden soll. Auf dem zentralen Marktplatz, wo es sich die Familien wünschen, lehnen es Stadtrat und Oberbürgermeister ab, weil »die Hanauer« das nicht akzeptieren würden. »Aber unsere Kinder waren doch auch Hanauer!«, ruft die Mutter des getöteten Sedat Gürbüz verzweifelt und Hamza Kurtovićs Vater Armin fordert: »Man muss die Leute mit dieser Tat konfrontieren, jeden Tag.« Ein erschütterndes Zeitdokument.
Gänzlich unzeitgemäß präsentierte sich hingegen Richard Linklaters »Blue Moon« im Wettbewerb um den Goldenen Bären: ein Kammerspiel über den amerikanischen Broadway-Texter Lorenz Hart (bis zur Unkenntlichkeit maskiert: Ethan Hawke), der am Abend des 31. März 1943 im New Yorker Restaurant Sardi's einem Empfang beiwohnt, bei dem sein ehemaliger Partner, der Komponist Richard Rodgers (Andrew Scott) seinen bis dahin größten Erfolg feiert – das Musical »Oklahoma!«; ausgerechnet das erste Werk, das ohne den notorischen Trinker und Neurotiker Hart entstanden ist. Regisseur Linklater, bekannt für seine Langzeit-Experimente wie »Boyhood« (2014) oder die »Before«-Trilogie (1995-2013), verliert sich in einem ambitionierten Dialogstück, in dem Hart als eloquente Nervensäge dargestellt wird, der frivol-sexistische Pointen aus der Hüfte schießt und in wehleidiger Theatralik mit der unerfüllten Liebe zur bildhübschen, aber naiven Elizabeth Weiland (Margaret Qualley) hadert. Trotz der virtuosen Dialoge, und zahlreicher cleverer popkultureller Referenzen (von »Casablanca« bis »Stuart Little«), letztlich ein altbackener Film, voller Klischees, dem außer einer ambivalenten Hommage an eine US-Showlegende, nichts Tiefsinniges einfällt. »Wer will harmlose Kunst?«, fragt Hart an einer Stelle und man wünscht sich, Richard Linklater hätte die Antwort.

.jpg)

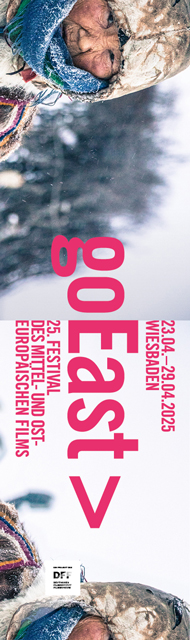
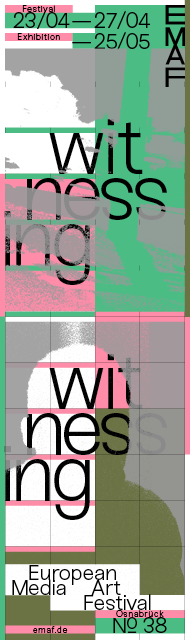

Ihre Meinung ist gefragt, Schreiben Sie uns