Berlinale: Politik auf Satin und episches Kino
Die Zutaten einer Berlinale-Eröffnung sind in jedem Jahr mehr oder weniger dieselben: Ein paar politische Bekundungen auf dem Roten Teppich, gefolgt von feierlichen Ansprachen über die Krisenherde der Welt und die wichtige Rolle des Kinos darin. In diesem Jahr war alles ein bisschen anders.
Zum einen, weil es der erste Festival-Jahrgang unter der neuen Leiterin Tricia Tuttle ist. Zum anderen, weil der Skandal um die Preisverleihung im vergangenen Jahr mit ihren als zu einseitig empfundenen Palästina-Solidaritätsbekundungen noch immer seinen Schatten wirft. Und zum dritten, weil es am Donnerstagabend in Berlin so viel Schnee gibt, dass sich Publikum, Stars und angereiste Polit-Prominenz wie in eine Wintermärchenwelt versetzt sehen.
Eventuell erwartete Eklats blieben erstmal aus. Auf dem Roten Teppich enthüllten die Schauspielerinnen Anna Thalbach und Meret Becker einen Schal mit der Aufschrift »Humanity for all«. Christian Berkel, Andrea Sawatzki, Martina Gedeck, Ulrich Matthes und andere ließen sich mit der neuen Festival-Leiterin Tuttle dabei fotografieren, wie sie Fotos hochhalten, die die Freilassung der Hamas-Geisel David Cunio fordern.
Cunio war 2013 als Schauspieler Berlinale-Gast und beim Terrorangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 entführt worden. Dass im Kontext der letztjährigen Solidaritätserklärungen niemand auf sein Schicksal einging, war stark kritisiert worden. Nun gibt es einen Film über ihn zu sehen: »A Letter to David« von Tom Shoval, der Cunio in seinem Film »Youth« von 2013 besetzt hatte.
Das meiste Aufsehen vor dem Berlinale-Palast erregte Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die ein bodenlanges, weißes Satinkleid trug, auf dessen Rückseite »Democracy dies in Daylight« stand. Und auf der Vorderseite die Vornamen Donald & Elon & Alice in schwarzen Lettern, darunter in grauen Buchstaben Friedrich, jeweils mit Fragezeichen.
Feierlich und ernst wie selten geriet auch die Verleihung des Ehrenbären für ihr Lebenswerk an Tilda Swinton. Edward Berger, derzeit der deutsche Regisseur mit dem größten internationalen Erfolg (»Konklave«, »Im Westen nichts Neues«), hielt die Laudatio. Bereits seit 1986 sei Swinton mit 26 Filmen mit der Berlinale verbunden. Die 64 Jahre alte Ausnahme-Schauspielerin bedankte sich mit einer poetischen und gleichzeitig politischen Rede.
»Für humane Solidarität zu sein, bedeutet, für humane Solidarität mit allen Menschen zu sein«, betonte Swinton. Gleichzeitig beschwor sie das Kino als »von Natur aus inklusiv« und »immun gegen Bestrebungen der Besetzung, der Kolonisierung, der Übernahme, des Besitzes oder der Entwicklung von Riviera-Eigentum« – eine Spitze gegen US-Präsident Donald Trump.
Eloquent und überzeugend beschwor die neue Leiterin Tricia Tuttle in ihrer Eröffnungsrede die Liebe zum Kino als Raum der friedlichen Auseinandersetzung. Und der deutsche Regisseur Tom Tykwer war der erste, der diesen Raum gleichsam füllen durfte. »Das Licht« ist Tykwers erster Kinofilm nach fast zehn Jahren. Nach »Heaven« (2002) und »The International« (2009) ist es bereits das dritte Mal, dass der »Lola rennt«-Regisseur den Eröffnungsfilm stellt.
Anspruch und Umfang von Tykwers Film passen zum diesjährigen Festival und der Weltlage wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Im Berlin seines Films, in dem eine vierköpfige Familie im Vordergrund steht, fällt Dauerregen. Vater Tim (Lars Eidinger) führt das große Wort in einer Werbeagentur, Mutter Milena (Nicolette Krebitz) pendelt zwischen Berlin und Nairobi, wo sie ein Theaterprojekt für kenianische Kinder auf die Beine stellt. Ihre 17-jährigen Kinder sind typische Teenager: Jon (Julius Gause) daddelt tagelang in seinem zugemüllten Zimmer mit VR-Brille Computerspiele. Zwillingsschwester Frieda (Elke Biesendörfer) zieht mit Freunden drogenschluckend durch die Clubs und plant Aktionen gegen die Klimakatastrophe.
Sie alle sind so beschäftigt mit sich, dass sie erst mit Verspätung bemerken, dass ihre polnische Putzfrau bei der Arbeit von einem Herzinfarkt ereilt wird. Dann kommt mit der aus Syrien geflüchteten Farrah (Tala Al-Deen) eine neue Haushaltshilfe in ihr Leben, die zu jedem einzelnen der Familienmitglieder ein besonderes Band knüpft, während sie gleichzeitig Linderung für ihr eigenes Trauma sucht.
Tykwers Film schlägt nicht nur mit seiner Länge von 160 Minuten über die Stränge. Auch in der Form streckt er seine Fühler nach allen Seiten aus. Es gibt Animationssequenzen und Geisterszenen und wieder und wieder Drohnen-Flüge über verschiedene Stadtteile von Berlin. Tykwer spricht den Generationenkonflikt, Klimaaktivismus, Digital-Malaise, Rentenprobleme, sexuelle Frustration und Migration an. Dank seiner großartigen Schauspieler – Lars Eidinger und Nicolette Krebitz geben mit viel Mut zum Unschönen Porträts der Ü-40-Generation – gelingt ihm ein forderndes und auch frustrierendes, aber ungeheuer stimmungsvolles Stück Kino.

.jpg)

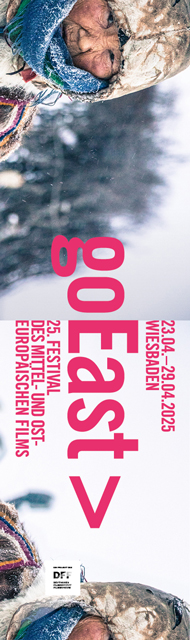
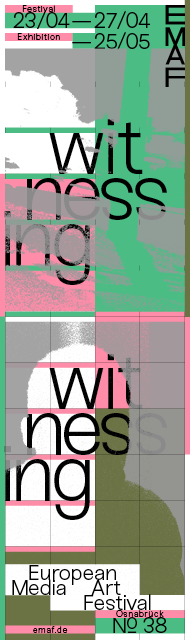

Ihre Meinung ist gefragt, Schreiben Sie uns