Berlinale: Klassenkampf im Weltall
Wie kann das Kino auf die desolate Lage der Welt reagieren, welche Geschichte sollte es heute erzählen? Und was wird dann aus dem traumhaften, fantastischen Moment des Films, dem Kino als Gegenerzählung? Das sind Fragen, die auf der am Donnerstag eröffneten 75. Berlinale immer wieder in Reden und Interviews gestellt werden.
Der Südkoreaner Bong Joon-ho hatte 2019 mit dem oscarprämierten »Parasite« eine stimmige Form gefunden, die verschiedenen Anforderungen zu verbinden: in einem satirischen Thriller, der zwei Familien in einer Nobelvilla Klassenkampf aufführen ließ.
Nun hat der Regisseur seinen neuen Film vorgestellt, eine Science-Fiction-Geschichte: »Mickey 17« ist gesättigt mit potenziell zeitkritischem Material. Unser Planet ist ruiniert, die Menschen migrieren massenhaft ins All. Ein Verlierer namens Mickey Barnes (Robert Pattinson) hat bei einer Expedition angeheuert, ohne das Kleingedruckte im Vertrag zu lesen: Er reist als »Expendable«, als einer, der für tödliche Experimente und Missionen vorgesehen ist, und nach jedem Ableben als Kopie aus dem Hightech-Drucker läuft. Es geht um Ausbeutung, Rassismus, Techno-Faschismus.
Über allem thront Mark Ruffalo als irrer Autokrat, der auf einem Eisplaneten eine Kolonie genetisch perfekter Menschen gründen will – auch, wenn er dafür die Indigenen ausrotten muss, ein Volk knuddeliger Maden. Schon eine frühe Folge »Star Trek« hätte diese Fabel in 50 Minuten ohne inhaltlichen Verlust auf die Reihe gebracht. »Mickey 17« allerdings erzählt sie in redundanten Schleifen und ziemlich geschwätzig, mit immerhin hübschen Alien-Effekten.
Klassenkampfgestählt ist auch der mexikanische Regisseur Michel Franco, der 2020 in »New Order – Die neue Weltordnung« eine Upper-Class-Hochzeitsgesellschaft mit einem Aufstand der Prekarisierten konfrontiert hatte. In seinem Wettbewerbsbeitrag »Dreams« nimmt Franco die inzwischen zum Kino- und Serienklischee abgesunkene Erkenntnis, dass Superreiche selten nett und oft gar nicht mal glücklich sind, wieder auf, allerdings in modifizierter Form.
Erzählt wird von einem jungen Balletttänzer aus Mexiko-Stadt, der unter großen Strapazen illegal in die USA auswandert. Er ist auf den Spuren einer älteren Frau, mit der er eine rauschhafte Zeit verbracht hat. Allerdings passt Fernando (Isaac Hernández) nicht recht in das Leben der attraktiven, verwöhnten Jennifer (Jessica Chastain), die als Single eine Kulturstiftung ihrer hochvermögenden Familie mitverwaltet. Das Begehren der beiden hält dem Druck der Sphäre, in der Jennifer sich bewegt, nicht stand, und es entfaltet sich ein Machtspiel, in dem nur sie gewinnen kann.
Differenzierte Bilder für die Strategien, die Lügen und Neurosen einer urbanen, hyperreichen Kulturblase, die sich selbst für aufgeklärt hält, findet der Film allerdings nicht. Chastains beständig wechselnde Designer-Outfits und ihre elegante Blässe sind die nahezu einzigen Indikatoren für den obszön verschwenderischen Lebensstil der Superreichen.
So überzeugen in diesen ersten Festivaltagen vielleicht doch eher die Filme, die nicht auf Welterklärung aus sind, sondern sich entschlossen fokussieren. »Living the Land« von Huo Meng taucht mit einer Mischung aus Landschaftsbildern und turbulenten Genreszenen in das Leben eines bäuerlichen Dorfs Anfang der 90er Jahre in China ein, einer Zeit des Umbruchs. Das Kunststück des Films besteht in der Geduld, mit der er eine unübersichtliche, chaotische Menge von Personen und Aktivitäten – Pflanzen und Ernten, Arbeit und Spiel, Feiern und Trauern – in eine schlüssige Gesamtkomposition überführt: Den Dingen sehr nahezukommen, kann den Blick wunderbar öffnen.
Das gilt auch für den französisch-belgischen Wettbewerbsbeitrag »Ari« von Léonor Serraille, in dem eine fragmentierte, auf extreme Close-Ups gepolte Inszenierung einem gescheiterten Referendar (Andranic Manet) und den Freunden, bei denen er vorübergehend Unterschlupf sucht, praktisch ins Gehirn zu kriechen sucht. Dem »Miserabilismus« seiner Figuren setzt der Film typisch französische Bewältigungstechniken entgegen: Eine Flasche Wein, eine Zigarette, eine Pfanne Crevettes haben schon immer geholfen.

.jpg)

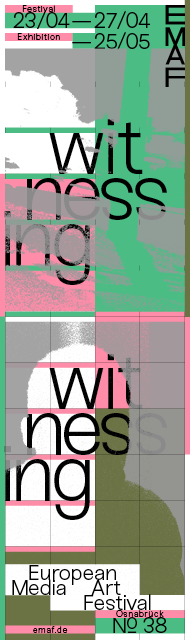

Ihre Meinung ist gefragt, Schreiben Sie uns