Die Geister sprechen
Ein kleiner Sport, der durchaus in die Zuständigkeit der Kritik gehört, ist die Frage, ob einem Film eventuell Anachronismen unterlaufen sind. Man kann ihn ohne Schadenfreude ausüben. So war ich beispielsweise beruhigt, dass die Vokabeln "Fabrik" und "Tourist" bereits in den 1830er Jahren existierten und Robert Eggers bei „Nosferatu“ diesbezüglich kein Fehler unterlaufen ist. Mit »Der Graf von Monte Christo« kommt in dieser Woche ein weiterer Film heraus, der in der gleichen Epoche angesiedelt ist und die Frage aufwirft, ob damals schon Poker gespielt wurde?
Laut dem einschlägigen Wikipedia-Eintrag könnte es gerade so hinkommen. Der Begriff wurde ab 1836 gebräuchlich. Vorformen des Kartenspiels existierten schon eine Weile, namentlich im arabischen Raum. Dass der Titelheld von ihm Kenntnis hat, muss nicht verwundern. Sein Schicksalsgenosse Abbé Faria hat ihn während ihrer Festungshaft im Chateau d' If eine beträchtliche Weltläufigkeit gelehrt, die er nach seiner Flucht auf zahlreichen Reisen vertiefen konnte. Ohnehin bemüht sich die Neuverfilmung um eine gewisse Authentizität. Dass ein junger Seemann wie Edmond Dantès braungebrannt auftritt, leuchtet sofort ein. Tätowiert waren Seeleute seinerzeit bestimmt auch. Woher indes der unerschöpfliche Vorrat an Kerzen stammt, der den Fluchttunnel des Abbé und seines Schützlings zuverlässig erhellt, bleibt ein Geheimnis, welches das Drehbuch ehern hütet. Ich nehme das mal als eine lässliche Flunkerei, denn ansonsten hat mich der Film mächtig überzeugt. Daheim in Frankreich erging es rund neuneinhalb Kinogängerinnen und Kinogängern ebenso.
Ob »Der Graf von Monte Christo« diesen Erfolg hier zu Lande auch nur annähernd wiederholen wird, ist eine spannende Frage, die sich wiederum (wenngleich auf andere Weise) mit dem Problem des Anachronismus verbindet. Wir sind epischen Filmereignissen aus Frankreich nämlich gründlich entwöhnt worden. Die letzten Beispiele liegen Jahrzehnte zurück, „Indochine“ mit Catherine Deneuve etwa oder »Cyrano de Bergerac« sowie »Mathilde – Eine große Liebe« von Jean-Pierre Jeunet. Abgesehen von Action-Reißern aus der Luc-Besson-Schmiede (die freilich ihre beste Zeit hinter sich hat) reüssieren bei uns nur noch importierte Wohlfühlkomödien. Und nicht einmal auf deren Strahlkraft ist inzwischen mehr Verlass. Vom größten letztjährigen Kassenschlager in Frankreich, »Was ist schon normal?« nahm das hiesige Publikum kaum Notiz. In günstigeren Zeiten hätte die Inklusionskomödie vielleicht gar ein gesellschaftliches Phänomen werden können wie »Ziemlich beste Freunde«. Die zwei vorangegangenen Dumas-Verfilmungen aus dem Hause Pathé, von denen nur die erste es überhaupt in unsere Kinos schaffte (siehe "Breit aufgestellt" vom 2.8. 2024) sind da keine guten Auguren. Das Produktionsgespann Jérôme Seydoux-Dimitri Rassam ist auf volles Risiko gegangen, als es den Bühnen- und Drehbuchautoren Alexandre de la Patellière und Mathieu Delaporte diesmal auch die Regie anvertraute. Auf dem heimischen Markt haben sie die Partie gewonnen, beim Export werden die Karten neu gemischt.
In friedlicheren Zeiten nannte die Branche solche Blockbuster gern "machines de guerre": schwere Geschütze im Wettbewerb mit der übermächtigen Konkurrenz aus Hollywood. Diese fürchtet man in Frankreich inzwischen weniger als die Streamingplattformen. Auf den neuen »Monte Christo« mag man die martialische Metapher schwerlich münzen. Er atmet zwar gehörig Zwietracht, handelt immerhin von Verrat und Rache, kommt dabei aber mit bemerkenswert wenigen Action-Szenen aus. Als Ereignis, das nur auf der großen Leinwand wirklich zur Geltung kommt, setzt der Film vielmehr andere Maßstäbe. Man sieht ihm den Gestus der Überbietung an, er prunkt mit verschwenderischen, atemraubenden und oft erlesenen Schauwerten und einer unverwüstlichen Intrige. Ihr Film ähnelt eher »Der Leopard« als »Batman«, gaben die frischgebackenen Regisseure selbstbewusst zu Protokoll. Das ist gar nicht so hochstaplerisch, wie es klingt. Neue Viscontis sind die Zwei mitnichten, aber dass sie sich auf europäische Traditionen berufen (Pathé war damals Mitproduzent von »Der Leopard«, dem zögerlichsten aller Breitwandepen), ist gescheit.
Ihre Besetzung ist smart. Der Titelheld, seine Gefolgsleute und Gegenspieler wirken erheblich jünger als ihre Vorgängerinnen und Vorgänger in diesen Rollen. Niemandes Ruhm steht der jeweiligen Figur im Wege. Einige Namen sind geläufig (Pierre Niney, Anais Demoustier, Laurent Lafitte – Pierfrancesco Favino erkennt man zwar kaum hinter dem Zehnjahresbart des Abbé Faria, aber er ist ein willkommener Bonus ), andere (Anamaria Vartolomei) werden es nach diesem Engagement zweifellos werden. Überhaupt ist dies ein Projekt der entschiedenen Verjüngung. Dieser »Monte Christo« ist durch die Schule der Moderne gegangen, ihm ist mithin eine Ambivalenz zugewachsen, die frühere Verfilmungen nicht in diesem Maße aufweisen.
Der historische Hintergrund, das Hin und Her zwischen Napoleon und der Bourbonenmonarchie, spielt eine überraschend untergeordnete Rolle. Es geht nicht um Daten, sondern Impulse. Das Regieduo versteht es, zu abstrahieren. Der Graf ist nachgerade existenzialistisch gezeichnet, seine Selbstentfremdung tragisch. Aber zwischendrin fällt dieser grandiose Satz "Wenn Ihr Gewissen rein ist, suchen die Geister sie nicht heim, sie sprechen zu Ihnen." Die Beweggründe seiner Verräter erscheinen privater, mithin universeller. Ihre Entlarvung bedarf nicht zwangsläufig der Öffentlichkeit. Die melodramatische Essenz der Situationen schöpft der Film maximal aus, ihr Action-Potenzial hingegen zögerlich: Zuerst die Gefühle, die Handlungen sind nur ihr Ausdruck. Das finale Degenduell akzentuiert diese Zwischenlage. Der Auftakt ist ein wenig lieblos fragmentiert, Verve entwickelt die Sequenz erst, als sie zum den Kern dieser Mantel & Degen-Konvention vordringt, der Vermeidung des Tötens. Das Geräusch der lasziv auf den Steinen schleifenden Säbelspitze ist derweil ein genialer Kunstgriff, der Genregeschichte schreiben wird.
Die Regiedebütanten sind vorerst noch Gesellen, die auf spektakuläre Gesten (majestätische Kran- und Heranfahrten, expressive Aufsichten) setzen, aber ihrem Stilbewusstsein nicht immer vertrauen können (die Zeitlupe, in der sich Villeforts Schicksal erfüllt, ist mir zu pathetisch). Als Szenaristen hingegen sind sie Meister. Sie fädeln die Intrigen und deren Vergeltung stets anders als erwartet ein. Des Grafen Ranküne gelingt, weil er sich geschickt maskiert. Das gab es so noch nicht in dieser Stoffgeschichte. Die vertrauten Plot-Elemente gewinnen unverhoffte Frische.
Sie werden ohnehin nicht sämtlich durch dekliniert. In Frankreich wird diese Geschichte traditionell als Zweiteiler präsentiert. Offenkundig haben die Beteiligten ja aus ihren "Musketieren" die richtigen Schlüsse gezogen. Mit knapp drei Stunden ist dies eine ungeheuer schlanke Dumas-Verfilmung. (Ich habe gut reden - den kompletten Roman kenne ich gar nicht, sondern habe als Schüler, gewissermaßen auf Anraten von Tom Sawyer, eine gekürzte Fassung gelesen.) Das Drehbuch macht keine Umstände, es steckt voller waghalsiger Ellipsen. Es weiht das Publikum nicht in jedes seiner Vorhaben ein. Seine Lakonie ist vernünftig: Warum das Unverzichtbare zeigen, wo es das Publikum doch längst kennt?

.jpg)

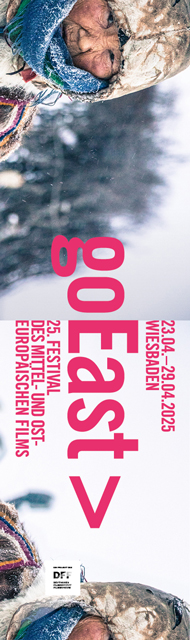
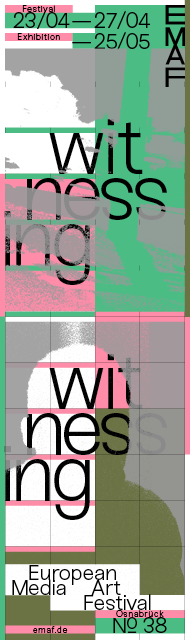

Ihre Meinung ist gefragt, Schreiben Sie uns