Kritik zu Im Schatten der Träume
Ein Dokumentarfilm über die künstlerische Partnerschaft und Freundschaft von Bruno Balz und Michael Jary, deren Lieder im Deutschland der 1930er (»Davon geht die Welt nicht unter«) und der 1960er (»Mama«) populär waren
Der Schock kommt am Schluss. Da erfährt man, dass das talentierte Duo aus Komponist und Textdichter, dessen Kunst man gerade über anderthalb Stunden zuhören durfte, auch das Lied »Mama« verfasst hat, mit dem ein holländischer Sängerknabe namens Heintje anno 1967 unsere Gehörgänge traktierte. Damit war er seinerzeit »omnipräsent im Fernsehen«, wie sich Götz Alsmann erinnert. Wenn Alsmann allerdings hinzufügt, diese Schallplatte hätten damals alle Neunjährigen für ihre Mutter zum Muttertag gekauft, ist man schon halbwegs wieder versöhnt mit dem, was einem damals als gruselig vorkam.
Im Gedächtnis werden der Komponist Michael Jary und sein Textdichter Bruno Balz vielleicht auch weniger für »Mama« bleiben, sondern für jene Lieder, die sie während des Dritten Reiches vor allem für Zarah Leander schrieben, Lieder mit (scheinbar) programmatisch-propagandistischen Titeln wie »Davon geht die Welt nicht unter« und »Ich weiß, es wird einmal ein Wunder gescheh'n«, Lieder, die durch ihren Einsatz in entsprechenden Filmen noch einmal zusätzliche Aufmerksamkeit bekamen. Jary und Balz deshalb als künstlerische Erfüllungsgehilfen des Nationalsozialismus abzutun, wäre jedoch verfehlt.
Das Schöne am Dokumentarfilm »Im Schatten der Träume« ist, dass er die Ambivalenz dieser Texte in den Mittelpunkt rückt, eine Ambivalenz, die einerseits anknüpfen kann an das Subversive etwa der 1933 entstandenen Filmkomödie »Viktor und Viktoria« um eine Frau, die sich als Mann verkleidet, der auf der Bühne als Frau auftritt, andererseits an die Tatsache, dass Balz schwul war und auch schon einmal wegen des § 175 verurteilt wurde. 1936 verhaftet, kam er schnell wieder frei nach Intervention Jarys, der erklärte, ohne ihn könne er nicht arbeiten. Möglicherweise hat dabei Joseph Goebbels selber seine Hand im Spiel gehabt.
Während der Musiker Götz Alsmann fachkundig, aber auch für musikalische Laien verständlich, die Musik kommentiert und darauf hinweist, dass der offiziell verpönte Jazz im Dritten Reich durchaus präsent war, wird die Ambivalenz der Texte vor allem von Rainer Rother, dem scheidenden künstlerischen Direktor der Deutschen Kinemathek, analysiert. Überhaupt hat Regisseur Martin Witz seine Gesprächspartner gut ausgewählt: Es sind nur wenige und sie dürfen ihre Überlegungen in längeren Statements formulieren. Die Kunst, »etwas zu erwähnen, ohne es zu benennen« (wie Klaudia Wick von der Deutschen Kinemathek formuliert), ist in den Arbeiten des Duos stets präsent.
Vom extrovertierten Jary entwirft der Film dabei ein umfassenderes Bild als vom introvertierten Balz, nicht zuletzt durch Erinnerungen seiner Tochter Micaela Jary. Der Mann war so populär, dass er in den fünfziger Jahren von Autogrammjägerinnen belagert wurde und Artur Brauner ihn im Spielfilm »Große Star-Parade« als sich selber auftreten ließ. Gerne hätte man mehr dokumentarische Aufnahmen der beiden Künstler gesehen, aber auch so ist »Im Schatten der Träume« als erhellender Beitrag zur populären deutschen Kultur höchst gelungen.



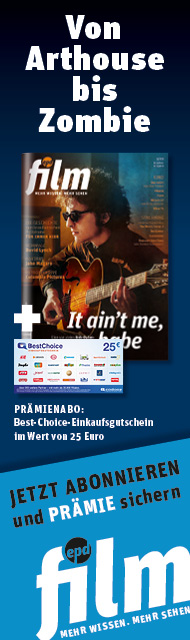
Ihre Meinung ist gefragt, Schreiben Sie uns