Filmförderungsgesetz: Auf der Strecke geblieben
Kurz vor dem Ende des letzten Jahres passierte das novellierte Filmförderungsgesetz den Bundestag. Doch das war nur das erste Teilstück einer vorerst auf Eis gelegten großen Reform
Um 21.45 Uhr am 19. Dezember 2024 nahm der Deutsche Bundestag das im Haus der Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) neu formulierte Filmförderungsgesetz (FFG) mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP an. Das neue FFG ging ziemlich kurz auf knapp über die Bühne. Am 1. Januar wäre das alte Gesetz ausgelaufen. Das Gesetz ist essenziell für die Branche, es regelt nämlich auch die sogenannte Filmabgabe, die Kinos, TV-Sender und Streamingportale in die Filmförderungsanstalt (FFA) einzahlen, immerhin rund 70 Millionen Euro. Das neue FFG sieht jetzt eine deutliche Stärkung der FFA vor. Die Vergabeabläufe der FFA-Mittel sollen künftig weitgehend automatisiert nach dem Referenzprinzip erfolgen: Ein Film sammelt Punkte durch Zuschauererfolge, Filmpreise (allerdings nur Deutscher, Europäischer und Oscars) und Festivalteilnahmen, die dafür bereitgestellten Gelder können dann für das nächste Projekt verwendet werden. Die Schwelle sind 150 000 Punkte. Die FFA wird aber in Zukunft auch die jurybasierte kulturelle Filmförderung des Bundes, die bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) angesiedelt war, verwalten sowie, wie bisher, den Deutschen Filmförderfonds DFFF und den German Motion Picture Fund GMPF.
Dass das novellierte FFG den Bundestag passiert hat, ist die gute Nachricht. Für die Produktionsfirmen bedeutet das erst mal eine gewisse Planungssicherheit, die Branche hat die Novellierung ziemlich einhellig begrüßt. Doch es gibt weit mehr schlechte Nachrichten und Fallstricke. Denn die Reform der FFA sollte ja nur ein Baustein unter mehreren sein. Die beiden Fonds mit ihren endlichen Mitteln sollten durch ein Steueranreizmodell ersetzt werden, das mit Steuernachlässen operiert. Andere Länder wie Großbritannien, Italien, Spanien oder Tschechien arbeiten längst mit einem solchen Modell, aufwendige Produktionen wandern daher häufig dorthin ab. Die Programmanbieter sollten weiterhin mit einer Investitionsverpflichtung, die es auch in anderen Ländern gibt, zur Kasse gebeten werden. Diese große Reform der Filmförderung des Bundes ist erst mal vom Tisch. Und von Claudia Roths angekündigten Absprachen mit den Länderfilmförderungen hat man auch noch nichts gehört. Das automatisierte Referenzprinzip der FFA soll ja zu einer Beschleunigung der Abläufe führen. Das bringt aber nichts, wenn die anderen Förderer nicht mitziehen.
Nun kann man der BKM nicht vorwerfen, dass die Ampel zerbrochen ist. Sicherlich aber, dass ihr Haus viel zu lange brauchte, um die große Reform einzutüten. Die Vorschläge lagen schon lange auf dem Tisch. Die Kardinalfrage an das neue Gesetz ist aber, ob genügend kulturelle Aspekte berücksichtigt werden. Und da sieht es nicht gut aus. Zum einen bleibt abzuwarten, ob der Wegfall der FFA-eigenen Projektfilmförderung durch das Referenzprinzip kompensiert werden kann. Denn bei der Projektförderung zählt nur das Projekt, nicht der vorherige Erfolg. Zum anderen lässt das neue FFG das Anrechnen eines Prädikats »besonders wertvoll« der Deutschen Film- und Medienbewertung (FBW) nicht mehr zu, was jahrzehntelang so praktiziert wurde. Durch das Prädikat »besonders wertvoll« der FBW konnte bislang die Schwelle für die Referenzförderung gesenkt werden, um 50 000 Referenzpunkte. Der Bundesrat hatte in seiner Stellungnahme zum Novellierungsentwurf im Juli noch gefordert, die beiden Prädikate »besonders wertvoll« und »wertvoll« zu berücksichtigen, die BKM hat sich aber darüber hinweggesetzt. Das Gütesiegel der von den Ländern betriebenen FBW war bislang das einzige anzurechnende Kriterium für die Referenzfilmförderung außerhalb der Festivalteilnahmen und hochkarätigen Preise. Es gibt keinen vernünftigen Grund, es aus dem FFG zu streichen – außer einer kulturpolitischen Borniertheit.
Einzige Kriterien für kulturelle Referenzpunkte sind neben den drei Preisen nun nur noch Festivalteilnahmen und dort gewonnene Preise. Da gibt es eine Liste (Stand 17.10.2024): »Richtlinie D.2«. Sie berücksichtigt vor allem ausländische Festivals (wegen ihrer Schaufensterfunktion für den deutschen Film); viel kulturelle Referenz kann von da nicht kommen – wie oft haben es in den vergangenen Jahren deutsche Filme in den Wettbewerb von Cannes geschafft (bringt 100 000 Referenzpunkte) oder ihn sogar gewonnen (bringt 200 000)? Nicht anerkannt wird, dass viele gerade kleine Filme oft eine große Festivalrunde auf internationalen wie nationalen Festivals drehen und dort möglicherweise von mehr Zuschauern gesehen werden als später im Kino. Und Preise gewinnen, die nicht anrechenbar sind. An deutschen Festivals sind für Spielfilme – außer der Berlinale – nur München und Saarbrücken berücksichtigt (50 000), aber nur wenn der Film den Wettbewerb gewinnt. Diese Liste muss dringend reformiert werden, sonst bleibt die Kultur draußen.

.jpg)

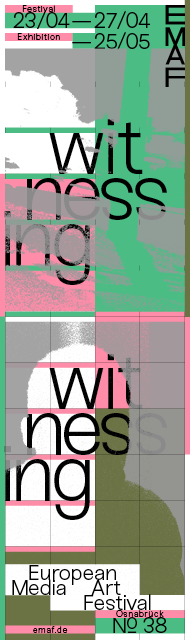

Ihre Meinung ist gefragt, Schreiben Sie uns