Nachruf: Thomas Heise
Thomas Heise (2019). © GM Films
22. 8. 1955 – 29. 5. 2024
Es wird der gesamten Arbeit von Thomas Heise natürlich nicht gerecht, aber dennoch: Er wird uns als der meisterliche Dokumentarist der deutschen Gesellschaft im Übergang bleiben, ein Menschenbeobachter in einer Situation, um es in seinen Worten zu sagen, in der »eine Utopie plötzlich möglich wird, und dann wieder kaputtgeht«. Thomas Heise hat in seinen Filmen eine andere Geschichte Deutschlands erzählt, aus dem Blickwinkel eines Menschen vielleicht, der, wie es in »Der Ausländer« von 1988 heißt, die Gemeinschaft derer, die ihn ausgeschlossen haben, so sehr hasst, dass dieser Hass in den Wunsch mündet, sich ihnen anzuschließen. Ein unmögliches Unterfangen und eine »unmögliche« Perspektive auf die Geschichte Deutschlands. Aber eine wahre.
Ein Geheimnis seiner Arbeit liegt vielleicht daran, dass er es nie auf etwas abgesehen hat, nie etwas »herausholen« will, er hört einfach zu, er sieht einfach hin, und daraus entsteht eben jene Stimmung, in der sich auch das Dramatische oder Widersprüchliche ereignet, ohne dass man es erwartet haben muss. Das ist es, was einen Dokumentarfilm von journalistischer Filmarbeit unterscheidet, dass er am Leben, nicht am Thema hängt. Die Zusammenhänge ergeben sich dann von ganz allein, weil das Leben selbst nur in Zusammenhängen geschieht. »Ich will auch nicht mehr wissen als das, was sie mir erzählen. Ich bin da nicht investigativ oder so.« Diese Direktheit besteht natürlich auch in der Auswahl der Menschen, mit denen man es in seinen Filmen zu tun hat. Das beginnt mit dem ersten Film, dessen Titel man sich durchaus als Frage von Kulturbehörden (der DDR, aber auch der BRD) vorstellen kann: »Wozu denn über diese Leute einen Film?« Leute, die nicht ins offizielle Bild passen, aber eben auch Leute, von denen man nicht schon vorher weiß, was los ist. Und am Ende antworten die, die es eigentlich nicht geben dürfte, die Kriminellen, Asozialen, Außenseiter, auf die Frage, welche Vorstellungen sie von der Zukunft haben: gar keine.
»Wozu denn über DIESE LEUTE einen FILM?«, so die korrekte Titelschreibung des Films von 1980, der erst neun Jahre später öffentlich aufgeführt werden konnte, verweist auf einen Grundwiderspruch des Filmemachens: dass Filme nicht nur einen Sinn haben, sondern auch einen Zweck erfüllen sollen. Diesem Zweckgedanken beim Filmen hat sich Thomas Heise immer verweigert, seine Filme sind nicht Aussagen, sondern Erfahrungen.
Die meisten Filme von Thomas Heise sind Filme mit Leuten. Das ist keineswegs selbstverständlich, denn die meisten Filme sind Filme über Leute. Doch die Frage »Wozu denn über diese Leute einen Film?« verfolgt Heises Arbeit auch über den Zusammenbruch der DDR hinaus in eine BRD, die eben so frei ist, wie es der Markt erlaubt.
1992 freilich wird mit »STAU – Jetzt geht’s los«, Teil der »Neustadt«-Trilogie, ein Nerv getroffen: Im Porträt rechtsradikaler Jugendlicher im trostlosen Halle-Neustadt kann sich das Deutschland, das gerade noch von blühenden Landschaften schwadronierte, nicht wiedererkennen. Heise hört auch hier den jungen Männern einfach zu, sieht sich in ihrem Leben und in ihrer Umgebung um. Manches wird deutlich über die Entstehung des rechtsextremen Weltbildes, manches bleibt rätselhaft. Es gibt keinen Kommentar, keine Distanzierung. Es ist nicht das Bild der »anderen«, kein Problembericht, es ist ein Bild dessen, was ist. Was geschieht zwischen Privatleben und Politik. Fast automatisch kommt da der Vorwurf, Heise habe den Nazis eine Bühne zur Selbstdarstellung gegeben und zeige sie nicht als Täter, sondern als Opfer. Man muss dem nicht folgen, und dennoch ist klar: Heises Methode ist riskant. Und sie wird weiter kontrovers bleiben, auch in NEUSTADT – Stau – Der Stand der Dinge: Zur Jahrtausendwende besucht Thomas Heise seine Protagonisten und ihre Familien noch einmal. »Nie klappt das Leben ganz und ist immer anders als vorgestellt. Erschöpfung ist das Wort, das die Stadt heute schreit. Das ist die eine Seite. Die andere, für diesen Film, ist Brechts ›Lesebuch für Städtebewohner‹. ... Da steht alles drin. Wenn man Brechts Gedicht ›Nach Unten‹ hinten dranhängt. Der Film ist eine andere Beschreibung der gleichen Vorgänge« (Heise). Vielleicht sind Heises Filme wirklich erst lesbar in einer kommenden Zeit: »Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut/in der wir untergegangen sind/gedenkt/wenn ihr von unsern Schwächen sprecht/auch der finsteren Zeit« (Brecht, »An die Nachgeborenen«).
Und dann gibt es doch so etwas wie eine Erklärung: »Wer nichts hat, nichts eigenständig hinbekommt, klammert sich ans Deutschsein« (Heise). Noch mehr dem aktuellen »Zweck« verweigert sich »Barluschke« (1997), kein Porträt, eher eine Momentaufnahme eines Menschen und seines Lebens zwischen dem Allerprivatesten und dem Allerpolitischsten. Joana und Berthold Barluschke trennen sich. Während sie noch auf eine Rückkehr zur »normalen« Familie hofft, arbeitet er, mit seiner wüsten Vergangenheit – von der Stasi nach Amerika und zurück nach Deutschland zum BND, immer Überzeugungstäter, immer Verräter – daran, »jemand zu sein«. Aber das gelingt ihm nicht, er und sein Leben, das passt nicht wirklich zusammen, und der Film gibt genau das wieder, einschließlich der Betrugs- und Selbstbetrugsmanöver. Dieser Barluschke ist nur bei sich, wo er außer sich ist, etwa wenn er eine Oper mitdirigiert, als wäre er da endlich Herr einer schönen Innenwelt. »Glaubst du, was du sagst, Bert?«, fragt Heise am Schluss, als Barluschke von künftigen »ordentlichen« Familienverhältnissen spricht. Und dieser antwortet: »Ja. Ich weiß das. Das ist keine Frage von Glauben.« Daraufhin wird es schwarz, und es erscheint der Satz: »Identität ist eine Mythe.«
Genau. Und der Zweck von Filmen, wenn es nach den entsprechenden Produktionsapparaten geht, liegt eben darin, diese Mythe zu erfüllen. Insofern kann man Thomas Heises Arbeiten auch als Antifilme beschreiben. Wozu über diese Menschen ein Film? Warum dieses hartnäckige Filmen, wenn damit doch buchstäblich nichts gesagt werden kann, wie etwa in »Sonnensystem« (2011), wo man nicht nur in eine fremde Welt eintaucht, sondern in eine fremde Sprache, die nur als Klang, nicht als Text zugegen ist. Und auch hier wird das Leben gezeigt, das nicht klappt und das nicht aufgeht, wieder eine Gesellschaft im Zustand des Verschwindens, weit weg nun, in der indigenen Gemeinschaft der Kollas in den Bergen Nordargentiniens. Und zurück dann in den eigenen Familienroman, in »Heimat ist ein Raum aus Zeit«.
»Man kann sich die Geschichte länglich denken. Sie ist aber ein Haufen.« So eröffnet Thomas Heise seinen Film »Material«, die Remontage seiner früheren Arbeiten. Eine Linie kann man vielleicht erzählen, aber einen Haufen, der Geschichte ist, und Geschichte, die ein Haufen ist, kann man nur filmen. Auch als Erbe nun werden es uns die Filme von Thomas Heise nicht immer leicht machen. Obwohl es in ihnen immer um das Allereinfachste geht, um die Leute und ihr Leben. Nur dass das eine eben niemals das andere vollständig erklärt, glücklicherweise, unglücklicherweise.
Die Bundeszentrale für politische Bildung bietet sechs Filme von Thomas Heise an: die »Neustadt«-Trilogie, »Eisenzeit«, »Imbiss Spezial« und »Heimat ist ein Raum aus Zeit«. Bei Vimeo gibt es weiteres Material, vor allem Kurzfilme, darunter »Der Ausländer«.

.jpg)

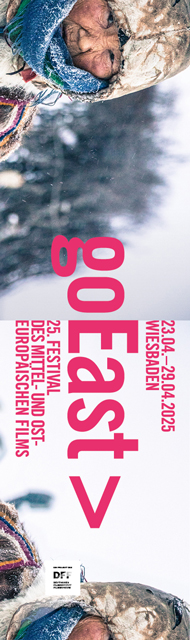
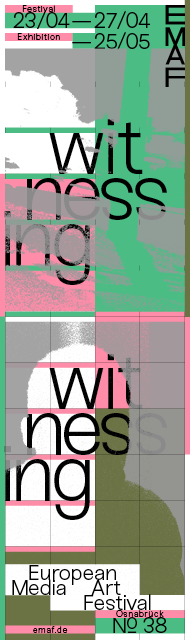

Ihre Meinung ist gefragt, Schreiben Sie uns