Das Schicksal der Klänge
Der gestrige Tag war für mich, wie für die meisten von Ihnen, ein besonderes Datum. Für die Aufgabe, einen solchen Gedenktag am besten zu begehen, gibt es keine Patentlösungen. Er verlangt nach einem Innehalten. Dafür existieren Konventionen und Formeln. In Auschwitz, im Bundestag und anderswo fielen wohlerwogene Worte über die historische Verantwortung. Als ich am Abend in die Philharmonie ging, ahnte ich nicht, welche Botschaft mich dort erwartete.
Ich ging nicht arglos in das Konzert, aber eventuell aus den falschen Gründen. Die weisen ja oft den richtigen Weg. Im Programmheft der Aufführung von »Henry V« hatte ich entdeckt, dass das Radiosinfonieorchester am 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz ein Streichquartett von Mieczyslaw Weinberg spielen würde. Meine Begleiterin und ich wurden sofort hellhörig. Wir kannten den polnischen Komponisten vor allem wegen seiner Partitur für "Wenn die Kraniche ziehen" von Michail Kalatosow. Mehrfach hatten wir aber auch über seine Oper gesprochen, die auf dem selben Roman der Auschwitz-Überlebenden Zofia Posmysz beruht, den Andrzej Munk in seinem letzten, unvollendeten Film »Die Passagierin« adaptiert hatte. Ein befreundeter Kollege hatte vor einigen Monaten in München eine Inszenierung gesehen, die ihn tief beeindruckte. Wir verabredeten uns. Allerdings buchte ich meinen Platz irrtümlicherweise im falschen Block, nicht G rechts, sondern G links. Das erwies sich als ein wundervolles Missgeschick, denn dort traf ich einen Freund, dessen armenische Vorfahren einen früheren Genozid erlitten hatten. Es lag ein Zauber über dem Abend.
Natürlich hätte ich mich besser auf ihn vorbereiten können. Da mir das Programmheft digital zugestellt worden war, unterließ ich es, vor Ort eines zu kaufen. Die Exemplare waren ohnehin in Windeseile vergriffen. Ich wusste also nicht, was hier Besonderes geschah und begriff es erst allmählich. Diese Überraschung will ich nun nicht mehr missen. Bereits vor zehn Jahren, zum letzten runden Jubiläum, waren in der Philharmonie Instrumente erklungen, die aus der Sammlung der Geigenbauer Mosche und Amnon Weinstein in Tel Aviv stammen. Sie umfasst rund 70 Streichinstrumente, die einst jüdischen Familien in Mitteleuropa, aber auch Deutschland und Frankreich gehörten und aus der Shoah gerettet wurden,. "Violins of hope" heißt diese Projekt, das über eine Website verfügt und zu dem auch ein gleichnamiges Buch existiert, das in der Pause auslag. Mit jeder Violine, jedem Cello und jeder Bratsche verbinden sich viele Lebensgeschichten, die mehr Opfer als Überlebende kennen. Amnon Weinstein starb im letzten Jahr, nun repariert und pflegt sein Sohn Avshalom die Instrumente. Zur Sammlung gehören Meisterstücke aus der Werkstatt Stradivaris in Cremona. Sie sind Zeugnisse einer großen Kultur. In viele von ihnen ist ein Davidstern eingraviert:, liebevoll und stolz, und noch arglos (vielleicht gerade so, wie ihn eingangs der Junge in »Fateless« trägt, der Verfilmung von Imre Kertész "Roman eines Schicksallosen" über die ich ursprünglich aus diesem Anlass schreiben wollte.) Heute früh fand ich einen schönen Artikel, den Christine Schmitt in der "Jüdische Allgemeine" (https://www.juedische-allgemeine.de/unsere-woche/saiten-der-erinnerung/) veröffentlichte und der von den Instrumenten und den Musikern handelt, die sie am gestrigen Abend spielten.
Das Konzert begann mit der Uraufführung einer Komposition von Berthold Tuercke, "Aus Geigen Stimmen", die eine Hommage an die Sammlung ist. Die Instrumente kamen nicht nur zu Gehör, der RIAS Kammerchor erzählte dazu mehrsprachig ihre Geschichte. Tuercke setzt die Violinen zunächst als Soloinstrumente ein und Dirigent Vladimir Jurowski adressierte jede Musikerin und jeden Musiker als Individuum, bevor das Orchester zum Ensemble verschmelzen konnte. Dieses reichte über die Bühne hinaus, der Chor war nicht nur in deren Mitte platziert, sondern auch auf zwei Rängen. Der Saal wurde für diesen Moment zu einem Terrain der großzügig verteilten Aufmerksamkeit. Beim langen Schlussapplaus streckten die Orchestermitglieder ihre Instrumente in die Höhe. Sie verneigten sich vor ihnen erhobenen Hauptes. Keine Virtuosität sollte sich vor ihre Zeugenschaft stellen.
Auch das weitere Programm wurde ausschließlich mit Streichinstrumenten bestritten. Gideon Kleins "Trio für Violine, Viola und Violencello", gewissermaßen auf dem Weg nach Theresienstadt verfasst, besaß in meinen Ohren eine strawinskyhafte Dringlichkeit. (Sie wissen ja, dass an dieser Stelle kein gelernter Musikkritiker schreibt, sondern ein verzückter Laie.) Eine Mitinhaftierte rettete die Partitur, bevor Klein nach Auchschwitz deportiert wurde. Die Chronik der „Violins of Hope“ ist voll solcher Geschichten der Überlieferung, in denen ein bedrohtes Vermächtnis in fürsorgliche Hände gerät. Jurowski hatte von seinem Orchester gelernt: Nun hielt er die Partitur in die Höhe, ebenso wie beim letzten Stück des Abends.
Auch Weinbergs Streichquartett war als Orchesterfassung eingerichtet. Sein Reichtum an Farben und Emotionen ist betörend. 1945 komponiert, legt sie Zeugnis ab von einer Entwurzelung, die sich nach Anmut und Unschuld sehnt. Weinberg findet auch Raum für zarte, ja liebliche Passagen. An diesem Abend musizierten glückliche Hände. Meine Freunde und ich waren hingerissen. Wir waren nicht aus den falschen Gründen gekommen. Das Konzert wurde in Kooperation mit Deutschlandfunk Kultur veranstaltet, wo Sie es demnächst gewiss nachhören können. Hoffentlich bewahrt die Aufzeichnung ein wenig vom Zauber. In Zeiten, in denen es immer schwerer scheint, sich mit Anderen, Andersdenkenden zu verständigen, ist diese Musik beredt.

.jpg)

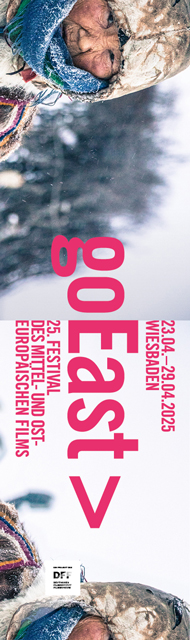
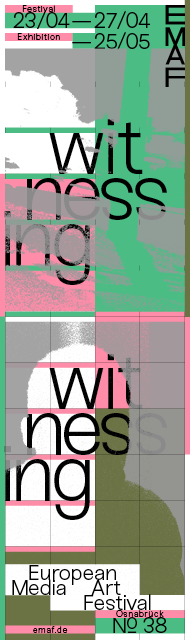

Ihre Meinung ist gefragt, Schreiben Sie uns