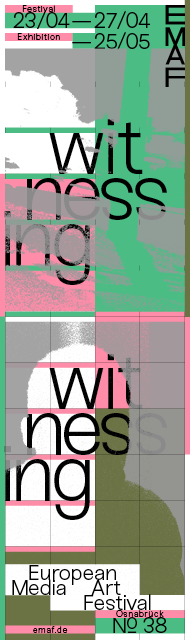News
07.03.2025
Pamela Hogan, ist eine amerikanische Produzentin, Journalistin und Regisseurin. Sie drehte den preisgekrönten Dokumentarfilm »Looks Like Laundry, Sounds Like Laury« und ist Co-Creator der Serie »Women, War & Peace«. Ihr mit Hrafnhildur Gunnarsdóttir realisierter Dokumentarfilm »Ein Tag ohne Frauen« startet am 13. März.

.jpg)