Berlinale: Ein Geschenk ans Publikum
© Richard Hübner / Berlinale 2024
Es ist ihre erste Berlinale als Leiterin und dann gleich eine Jubiläumsausgabe. Tricia Tuttle über Herausforderungen und Perspektiven des krisengeschüttelten deutschen A-Festivals
Tricia Tuttle. Die 55-jährige US-Amerikanerin zog 1997 nach Großbritannien, wo sie einen Master in Film Studies am British Film Institute und der Birkbeck University absolvierte. Im Anschluss war sie fünf Jahre für die British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) tätig, unter anderem als Filmprogramm-Managerin. Von 2013 bis 2023 arbeitete sie für das London Film Festival, zunächst als stellvertretende Leiterin und ab 2018 als Hauptverantwortliche. Im April letzten Jahres übernahm sie die Leitung der Berlinale.
epd Film: Frau Tuttle, für Ihre erste Berlinale haben Sie den US-Regisseur Todd Haynes als Jurypräsidenten auserkoren, die britische Schauspielerin Tilda Swinton erhält den Goldenen Ehrenbären. Ist das, neben der Würdigung zweier Filmkünstler, auch ein größeres Statement?
Tricia Tuttle: Das ist es durchaus. Ich bin ein großer Fan ihrer Arbeit. Über das Werk von Todd Haynes hatte ich schon meine MasterAbschlussarbeit geschrieben. Wir wollen zur 75. Berlinale Künstler*innen einbinden, die eine langjährige Beziehung zum Festival haben. Todd hatte mit Poison 1991 den Teddy Award gewonnen. Tilda ist so tief mit dem Festival verwurzelt wie kaum jemand sonst. Im Laufe der Jahre wurden 26 Filme mit ihr gezeigt, darunter ihr erster Film mit Derek Jarman, »Caravaggio« 1986. Das Gleiche gilt aber auch für Tom Tykwer aus Deutschland, um zu Ihrer Frage noch eine weitere Person zu ergänzen. Wir hatten wirklich Glück, dass er nicht nur einen unglaublich schönen neuen Film hat, mit dem wir nun die Berlinale eröffnen, sondern dass Tom auch eine weit zurückreichende Geschichte mit dem Festival verbindet.
Sie haben gerade das Jubiläum erwähnt. Wie begehen Sie den Fünfundsiebzigsten?
Wir konzentrieren die meisten unserer Aktivitäten am neu geschaffenen HUB75 am Potsdamer Platz, der ein Ort für unser Publikum und unsere Fachbesucher*innen sein wird. Dort wird es Veranstaltungen, Gespräche und Empfänge geben. Der Vormittag ist dem öffentlichen Publikum gewidmet, der Eintritt zu den Veranstaltungen wird gratis sein. Und nachmittags können sich dort Fachbesucher*innen treffen und Kontakte knüpfen. Wir wollten etwas machen, das sowohl eine Feier zum Jubiläum ist als auch ein Geschenk an unser Publikum. Dem Herzstück des Festivals möchten wir auch langfristig neue Kraft und Ausstrahlung geben und ein Zentrum schaffen, das Begegnungen schafft, die Menschen zu Austausch und Diskussion zusammenbringt. Es ist eine Einladung zum Dialog. Dem Jubiläum begegnen wir mit der grundsätzlichen Haltung, dass unsere Vergangenheit Teil unserer Gegenwart und auch Teil unserer Zukunft ist. Es ist also vor allem Anlass, nach vorn zu schauen. Dieses Festival war schon immer zugleich ein riesiges Publikumsfestival und sehr wichtig für die internationale Filmbranche. Und wir wollen, dass es das auch weiterhin bleibt, und neue Impulse setzen, denn die gesamte Filmindustrie hat in den letzten Jahren seit der Pandemie wirklich zu kämpfen gehabt.
Welche weiteren Änderungen können wir von Ihrer ersten Ausgabe erwarten?
Wir haben eine neue Wettbewerbssektion für Spielfilmdebüts geschaffen, »Perspectives«. Diese Reihe wird 14 Filmemacher*innen aus der ganzen Welt ins Rampenlicht rücken. Wir zeigen alle Filme im Bluemax Theater, das zum ersten Mal Spielort der Berlinale ist und dazu beiträgt, den Potsdamer Platz wieder als Festivalmittelpunkt zu etablieren. Ein Festival kann nur funktionieren, wenn die räumlichen Voraussetzungen dafür geschaffen sind. Die Infrastruktur aller unserer Veranstaltungsorte hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Und wenn man dann über die ganze Stadt verstreut ist, ist es schwer, diese Art von Energie, von Verbindung zu schaffen. Das habe ich auch in meiner Zeit beim London Film Festival gelernt, wo ich den Schwerpunkt rund um die South Bank konzentriert habe. Ich glaube aber, dass die Berlinale beides sein kann und sollte. Die Stadt hat unglaubliche Kinos in den Bezirken, weil es keine Stadt wie andere Großstädte ist, in der es nur einen einzigen Ort gibt, zu dem man die Leute lenken will. Diese Kiezkultur mit einer unglaublichen Geschichte und kulturellen Dimension ist sehr bereichernd.
Sie haben im April angefangen. Was waren die größten Herausforderungen und vielleicht auch Überraschungen?
Ich bin mit offenen Augen in den Job gekommen, weil ich wusste, dass wir einige finanzielle und infrastrukturelle Probleme haben. Wir müssen massive Haushaltslücken schließen und sind wirklich froh, dass wir in diesem Jahr bereits einige gute Fortschritte gemacht haben, bei den Sponsoren und Partnerschaften etwa. Auch auf das Problem mit fehlenden Spielstätten war ich eingestellt. Eine weitere Aufgabe wird sein, der internationalen Industrie weiterhin attraktive Angebote zu machen, so dass sie bleibt und sich engagiert. Das gilt so nicht nur für uns, sondern für jedes Filmfestival, denn die Leute reisen nicht mehr so viel. Seit der Pandemie können sie viel stärker Geschäfte aus der Ferne abwickeln, und es wurden verschiedene Strukturen geschaffen, um dies zu ermöglichen. Wir müssen die Berlinale so aufbauen, dass die Leute unbedingt hier sein wollen, weil sie sonst etwas verpassen. Die Voraussetzungen sind da, weil das Festival bereits so angesehen und so dynamisch ist. Wir hatten dieses Jahr mehr Filmeinreichungen denn je, und unser Markt ist wieder ausverkauft!
Haben Sie als Frau an der Spitze eines A-Festivals eine andere Führungskultur als Ihre Vorgänger?
Es ist schwer zu sagen, weil ich in meiner eigenen Welt lebe und nicht wirklich Einblick habe, wie andere Führungsstrukturen funktionieren. Mir ist echte Kollaboration wichtig mit Leuten, die ihre Arbeit wirklich gut machen, und von ihnen zu lernen und ihnen Raum zu geben. Und ich liebe es, kollektiv zu programmieren. Haben Sie in Bezug auf die Filme eine größere Sensibilität für bestimmte Themen? Vielfalt ist etwas, das ich immer lautstark und leidenschaftlich vertreten habe und das mich wirklich interessiert. Wie kann man sein Programm dynamischer gestalten, indem man über unterschiedliche Perspektiven nachdenkt, die man auf die Bühne bringen will? Die Suche nach Stimmen, die im internationalen Kino unterrepräsentiert sind, ist etwas, das mich wirklich begeistert. Vor 25 Jahren bedeutete das noch, Kompromisse eingehen zu müssen, um Raum zu schaffen für queere Stimmen, Filmemacherinnen und Filmemacher, die nicht über die entsprechenden Produktionsmittel verfügen. Das hat einer neuen Generation gezeigt, dass es auf Festivals Platz für sie gibt, und wir haben dazu beigetragen, ein Publikum für diese Arbeiten aufzubauen.
Welche dieser Stimmen sind für Sie Entdeckungen in diesem Jahr?
»The Ugly Stepsister« im Panorama ist das Regiedebüt von Emilie Blichfeldt. Eine norwegische Filmemacherin, die viele Genreelemente wie Körperhorror verwendet, um eine sehr feministische Variante des Märchens von Aschenputtel zu erzählen. Ich bin mir sicher, dass wir von ihr in den nächsten Jahren noch viel mehr sehen werden.
Wie haben Sie die Kontroverse nach der Preisverleihung und den einseitig propalästinensischen Statements einiger Filmemacher im vergangenen Jahr erlebt? Welchen Einfluss hatte es auf Ihre Arbeit?
Es war eine große Herausforderung, und ich habe, ohne zu übertreiben, 25 bis 30 Prozent meiner Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken, wie wir uns in der Situation, in der wir uns jetzt in der Welt befinden, positionieren können. Ich vermute, die meisten internationalen Kulturverantwortlichen denken in ähnlichen Kategorien, aber für die Berlinale ist manches anders, weil wir ein öffentliches Festival sind, ein wirklich internationales Festival mitten in Deutschland. Das ist für die Berlinale in ihrer 75-jährigen Geschichte an einem auch politisch immer spannenden Ort in Europa nichts Neues, aber eine besondere Position. Dass Deutschlands Beziehung zu Israel und die hiesige Holocaust-Gedenkkultur auch die Debatten über das Festival beeinflusst haben, ist meines Erachtens ausführlich dokumentiert. Für mich gilt: Wir haben als Berlinale die Aufgabe, Menschen aus der ganzen Welt zusammenzubringen und dafür zu sorgen, dass die Filme etwas über diese Welt erzählen können und für Verständigung sorgen. Dabei ist es wichtig, dass wir die Balance wahren und möglichst vielen Perspektiven gerecht werden. Das ist bisweilen schwer, aber es ist auch absolut wichtig, dass wir es tun. Und das Kino ist ein großartiger Ort dafür!
Die Berlinale gilt fast traditionell als das »politische Festival«.
Ich denke nicht, dass wir versuchen können oder sollten, den politischen Charakter dieses Festivals zu verleugnen. Es gehört zur DNA des Festivals, ohne Ängstlichkeit auch Werke zu zeigen, die vielleicht umstritten sind oder sich zu politischen Themen positionieren. Wir wollen nicht davon abrücken, mutige Arbeiten zu zeigen, auch weil es die Weltlage ohnehin erforderlich macht. Aber wir sollten uns auch wieder mehr auf die Filme selbst als eine wirkmächtige Kunstform konzentrieren. Ich möchte der Versuchung widerstehen, Filme auf die Themen zu reduzieren, die in ihnen vorkommen. Ich würde wirklich gern wieder über das filmische Geschichtenerzählen selbst sprechen.

.jpg)

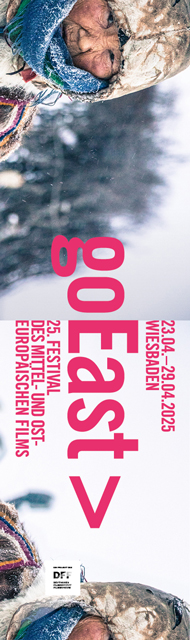
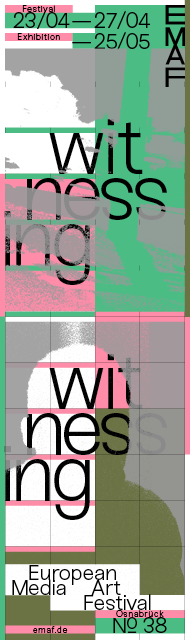

Ihre Meinung ist gefragt, Schreiben Sie uns