Es ist ein langes Stück
"Man könnte glauben, dass Ravel ein fantastischer Filmmusiker wäre", sagte Philippe Sarde einmal, "nur - er hatte keine Filme, für die er Musik hätte schreiben können." Seine Musik sei sehr visuell, fand der Filmkomponist, aber seltsamerweise sei es schwer, sie Bildern zu unterlegen, denn sie enthalte selbst schon alle Bilder.
Das war vor mehr als dreißig Jahren, als ich Philippe für eine Sendung der seligen Reihe "Kinomagazin" interviewte. Es ging um Claude Sautets „Ein Herz im Winter“, für den er mehrere Stücke adaptieren sollte. Seit »Die Dinge des Lebens« war er Sautets Hauskomponist und unverzichtbar auch bei dieser besonderen musikalischen Zusammenarbeit. Der Regisseur brauchte eine Musik, die nicht zu modern und nicht zu klassisch war. Er wählte einige unbekanntere Stücke Maurice Ravels aus, Auszüge aus den Sonaten, dem Trio, auch dem Blues. Sie erschienen ihm passend, weil sie zu dessen intimster Musik gehörten und die "geistige Atmosphäre zwischen den Personen" widerspiegelte. Die Stücke hatten den Vorzug, nicht zu melodiös zu sein. Kammermusik, die sich nicht vor die Bilder stellt. Für Philippe war das eine dankbare, aber komplizierte Aufgabe.
Als unser Kamerateam seine Ausrüstung aufbaute, fiel mir auf, dass unser Gastgeber auf dem Kaminsims kleine Modelle der Instrumente des Trios drapiert hatte. Sie sahen aus wie ernste Spielzeuge. Mein Kameramann war ganz vernarrt in sie und drehte lauter Nahaufnahmen. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie in der endgültigen Schnittfassung vorkamen. Das Interview dauerte gut eine Stunde, die Antworten sprudelten nur so aus Philippes Mund heraus. Ravel war einer seiner Lieblingskomponisten, aber die Stücke konnten nicht einfach als Playback eingespielt werden; Emmanuelle Béart spielte die Violine live, wofür sie ein Jahr lang geübt hatte. Für den Filmkomponisten war das durchaus heikel, denn er musste ein bisschen Hand anlegen, damit sie funktionierten. Er nannte das die Musik "neu lesen". Aber ohne Sakrileg, wie er immer wieder betonte.
Sautet erzählt in »Ein Herz im Winter« unermesslich viel vermittels der Musik: über die Gefühle, die sie birgt und auslösen kann. Er horcht auf die Verletzbarkeit der Musiker, ihre Gabe, sich beim Spielen zu öffnen, aber auch ihre Angst, sich dabei zu entblößen. Er hat ein genaues Ohr für das Timbre der Instrumente und auch für ihre Unvereinbarkeit mit anderen. Eine Dreiecksgeschichte, die um eine Violine kreist. Ein einzigartiger Glücksfall der Filmgeschichte, denn Ravels Musik "passt" nicht nur in den Film, sie besaß eine tiefe Affinität zu der intimen Geschichte, die Sautet zusammen mit dem Co-Autor Jacques Fieschi erdacht hatte. In der traurigen Liebesverweigerung Daniel Auteuils spiegelt sich ein Stück weit auch die vermutliche, tragische Keuschheit des Komponisten.
Sie ist ein leises, aber nie untergründiges Thema in Anne Fontaines »Bolero«, der in der letzten Woche bei uns anlief. Hier übernimmt Bruno Coulais von Sarde den Staffelstab des Ravel-Arrangeurs. (Beide Filme haben übrigens ein Stück gemeinsam). Britta Schmeis hat Fontaines Film begeistert im aktuellen Heft besprochen. Ich kam erst am Sonntag dazu, ihn anzuschauen, und pflichte ihr bei. Regelmäßig gelingt es ihm, die eigene Konventionalität zu sabotieren – kein Wunder, Fieschi hat auch diesmal am Drehbuch mitgewirkt. (Die zwei Produzenten von "Ein Herz im Winter" sind ebenfalls wieder mit von der Partie, Philippe Carcassone und Jean-Louis Livi.) Mir gefällt, wie er Ravels Impressionismus ins Filmische überträgt: Die Geräuschwelt muss ihn erst verführen, damit er zu seiner Komposition findet, sie entsteht allmählich, nicht wie ein Geistesblitz in einem handelsüblichen Hollywood-Biopic.
Der Kinostart bietet einen schönen Anlass zu einer tour d'horizon durch die Liaison zwischen Ravel und dem Kino. Die IMDb verzeichnet 301 Filme oder TV- Sendungen, in denen seinen Musik ertönt. Das sind fast doppelt so viele, wie zu Igor Strawinsky aufgelistet sind, aber zweihundert weniger als bei Claude Debussy. »Die leisen und die großen Töne« mit dem Streit um das berühmteste Lied der Welt (Johnny Hallyday hat das Nachsehen) und mit seinem mitreißend herzerwärmenden Bolero-Finale wird übrigens noch nicht erwähnt. Wie bei Debussy wird es eine erkleckliche Dunkelziffer der Inspiration, Verwandtschaft oder des Plagiats geben. Mir fallen auf Anhieb zwei Beispiele ein. In »Parthenope«, dem neuen Film von Paolo Sorrentino (läuft im April bei uns an), kommt an zwei neuralgischen Stellen eine Variation des Bolero vor, was gut zur Titelheldin passt, die eine Virtuosin des erotischen Aufschubs ist. Und als ich am vorletzten Sonntag auf arte einen triftig atmosphärische Konzertfilm zum 150. Geburtstag des Komponisten sah (https://www.arte.tv/de/videos/119953-000-A/maurice-ravel-musikalische-splitter/), fragte ich mich beim Auftakt von »La Valse«, an welches Filmthema er mich bloß erinnerte. An den Walzer aus »The Boys from Brazil« oder »Der große Eisenbahnraub«, die beide von Jerry Goldsmith stammen? Über die Eisenbahn kam ich schließlich auf die richtige Spur: die Sequenz, als sich der Zug in »Mord im Orient Express« langsam in Bewegung setzt. Ich bin mir sicher, dass Richard Rodney Bennett beim Komponieren dieses magistralen Stücks seinen französischen Kollegen im Ohr hatte.
Der Sender meint es übrigens in diesem Monat wirklich ernst mit der Feier von Ravels 150. Geburtstag. In der Mediathek finden sie eine tolle Episode des Filmmagazins „Blow up“ (https://www.arte.tv/de/videos/117679-021-A/blow-up-maurice-ravel-im-film/). Ich kann nicht recht entscheiden, ob sie mir die Arbeit ab- oder meinem heutigen Vorhaben den Wind aus den Segeln nimmt. Luc Lagier sortiert darin die Filmbeispiele zum Teil genauso, wie ich es getan hätte. Robert Guédiguian hat ein Faible für die „Pavane für eine verstorbene Prinzessin“ (kommt in »Der Schnee am Kilimanjaro« sowie „Gloria Mundi“ vor), „Daphnis und Chloé“ wird gern im südamerikanischen Urwald gespielt (in „Fitzcarraldo“ ebenso wie in »The Lost City of Z«) und in »Stalker« vermischt sich der Bolero mit dem Geräusch eines vorbeifahrenden Zuges (eine schöne Replik auf dessen mechanisch-industrielle Abkunft). Im gleichen Jahr (1979, ein wahres annus mirabilis der Ravel-Rezeption) findet das Stück seinen ulkigste Einsatz. In »Ten- Die Traumfrau« von Blake Edwards soll es das Liebesspiel von Bo Derek und Dudley Moore befeuern. "It's a long piece!" frohlockt Moore, der als Songschreiber an knapperen Längen gewöhnt ist, in Erwartung eines orgiastischen Crescendos. Dank der Edwardschen Tücke des Subjekts kommt es anders, aber so haben Amerikaner den Sex auf der Leinwand am zweitliebsten: als Slapstick.
Lagier zeigt sich in dem Beitrag einmal mehr als ein zuverlässiges Trüffelschwein (den "feurigen, bast bestialischen" Bolero, den Carole Lombard und George Raft im gleichnamigen Hollywoodfilm tanzen, will ich unbedingt einmal ganz sehen; nicht nur wegen ihres entzückenden Dekolletés); auch seine Top Five hat es in sich. Da die Überschrift sich mittlerweile als Menetekel erwiesen hat, will ich nur noch eine kleine Kuriosität hinzufügen. Als William Friedkin ein Stück 1977 in »Sorcerer« (Atemlos vor Angst) einsetzt, muss er sich das bei seiner damaligen Ehefrau Jeanne Moreau abgehört haben, die ein Jahr zuvor Ravel in ihrem Regiedebüt »L' adolescente« (Mädchenjahre) erklingen lässt. Fürwahr, ein unendlich inspirierender Komponist!



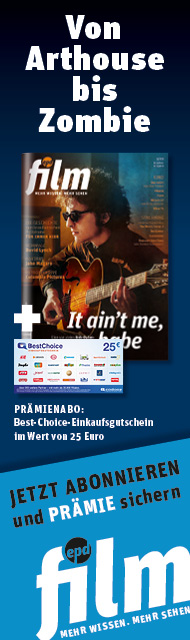
Ihre Meinung ist gefragt, Schreiben Sie uns