Kommandounternehmen Ausstellung
Zvi Malkin konnte den Gedanken nicht ertragen, seinen Gefangenen zu berühren. Dabei war er daran gewohnt, mit seinen Gegner auf Tuchfühlung zu gehen. Mit zwölf war er der Haganah beigetreten, später bildete ihn der Mossad zum Spezialisten für Sabotage Sprengstoff, aber auch im Nahkampf aus. Aber den Mann, den er nun bewachte, konnte er nicht anfassen.
Malkin war einer der elf Agenten, die Adolf Eichmann 1960 in Buenos Aires gefangen nahmen und nach Israel entführten. Er war hartgesotten und pflichtbewusst, aber dieser Auftrag war wie kein anderer, den er davor ausgeführt hatte. Seine Eltern waren 1933 mit ihm aus Polen nach Palästina geflohen, seine Schwester Fruma jedoch blieb mit ihren drei Kindern daheim zurück. Sie und 150 weitere Angehörige wurden im Holocaust ermordet. Also zog Zvi jedes Mal, wenn er den Logistiker der Massenvernichtung in der improvisierten Zelle aufsuchte, Handschuhe über.
Dem Geheimunternehmen und dem Prozess, der Eichmann in Israel gemacht wurde, ist die Ausstellung "How to catch a Nazi" gewidmet, die bis zum 1. 2. 2026 im Filmmuseum Potsdam läuft. Dort sind auch die Malkins Handschuhe zu sehen, freilich nicht die echten, sondern eine Skulptur, die er später nach einem Eisenguss der Kleidungsstücke formte. "Spione können auch Künstler sein", erklärte Kurator Avner Avraham mit einem stolzen Schmunzeln, als er durch die Schau führte. Ansonsten prunkt sie mit lauter Originalen, darunter amtlichen Dokumenten, Briefen, Flugtickets, falschen Pässen, Koffern, einem Apparat zur Herstellung von Nummernschildern, Kameras sowie der zugeklebten Brille, die Eichmann nach seiner Verhaftung tragen musste. Fast das gesamte Inventar des Kommandounternehmens ist hier zu besichtigen.
Wahrscheinlich ist dies (aber wer weiß das schon so genau?) die erste Ausstellung in einem Filmmuseum, die je von einem Spion kuratiert wurde. Avraham gehörte selbst dem Mossad an, zuletzt im Rang eines Oberstleutnant. 2010 stieß er im Archiv des Auslandsgeheimdienstes auf die beinahe vergessenen Fundstücke. Ein Jahr später konzipierte er eine erste Ausstellung in Israel. Seither arbeitet er als Publizist, Produzent und Berater – unter anderem für die Netflix-Produktion »Operation Finale« mit Ben Kingsley und Jason Isaacs. Das war auch der erste Titel dieser Schau, die 2016 nach Cleveland/ Ohio wanderte und danach in sieben weiteren US-Städten gezeigt wurde. Potsdam ist die zweite und wohl auch letzte Station der Schau nach München, wo sie im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst lief. Die Adolf Rosenberger gGmbH hatte sie dorthin geholt und um ein Outro ergänzt, das dem Umstand Rechnung trägt, dass sie nun im Land der Täter zu sehen ist. In München zog sie in acht Monaten 35000 Besucher an – insgesamt waren es bisher zehnmal so viel – und erhielt nach einer Umfrage unter Schülern und Studenten ihren jetzigen Namen. Dort sah sie auch Günther Jauch, den sie so sehr beeindruckte, dass er die Schirmherrschaft für die Potsdamer Fassung übernahm.
Sein Engagement ist nicht zuletzt der Freundschaft zu der Holocaust-Überlebenden Eva Erben geschuldet, die in Tel Aviv zu den treuen Zuschauern seiner Rateshow "Wer wird Millionär?" zählt. In der Schau ist die rüstige Dame in einem eindringlichen Interview präsent. In Potsdam ist die sie zudem um eine Position zur medialen Auseinandersetzung mit Verhaftung und Prozess ergänzt worden. Guido Altendorf und sein Team von Ausstellunsabteilung haben bisher 60 Filme und TV-Produktionen ermittelt (die Liste ist offen - wenn Ihnen weitere Titel einfallen sollten, melden Sie sich unter info@filmmuseu-potsdam.de). Eine Auswahl der Filme läuft ab April im Rahmenprogramm.
Die Chronik von Eichmanns Ergreifung, der in Argentinien den Decknamen Ricardo Klement trug und für Mercedes Benz arbeitete, beginnt übrigens mit einem Kinobesuch. Ein junger Mann, der sich als Nick Eichmann vorstellte, verabredete sich 1956 dazu mit einer jungen Frau namens Silvia Hermann. Ihr Vater Lothar, der Dachau überlebte hatte, wurde bei diesem Namen hellhörig und schrieb umgehend an den Frankfurter Staatsanwalt Fritz Bauer. Angesichts des restaurativen Klimas der Adenauer-Ära (schon in den 1950ern hatte das Land, um mit Andres Veiel zu sprechen, genug von seiner Schuld) wandte Bauer sich direkt an den Mossad.
»How to catch a Nazi« erzählt dies so zupackend wie einen Spionagethriller. Die Ausstellung richtet sich ausdrücklich auch an ein jüngeres Publikum, das womöglich noch nie von Eichmann gehört hat. Sie baut Brücken der Anschaulichkeit. Die Authentizität der Exponate ist beredt genug, sodass die zweisprachigen Bildlegenden kurz gehalten werden können. Der Wissenschaftlichkeit ist in diesem lehrreichen Parcours dennoch genüge getan. Aber diese Geschichte ist eben ungeheuer spannend. Eichmann gelang die Flucht auf der Rattenlinie, er fand in Italien Unterschlupf in Klöstern und Konventen, und in Lateinamerika einflussreiche Netzwerke vor, die ihn 15 Jahre schützten. Seine Häscher gaben sich als harmlose Touristen aus. Ihr Plan war akribisch ausgeklügelt, ein Handstreich, bei dem unter anderem eine Maschine der El Al (das einzige Mal, dass die Linie je Argentinien anflog) sowie ein Eichmann-Doppelgänger zum Einsatz kamen. Was trug der Nazi bei sich, als er gefasst wurde? Einen Kamm, ein winziges Taschenmesser, eine Zigarettenspitze und Schlüssel. Er leugnete nicht, Eichmann zu sein.
Der Prozess spielt die zweite zentrale Rolle in der Schau. Beim Presserundgang zeigte sich Avraham als Patriot mit Geschichtsbewusstsein. "Unser Premierminister David Ben Gurion war sehr klug", berichtete er. "Er wollte nur einen einzigen Nazi-Prozess. Der sollte nicht einem Handlanger gemacht werden, sondern einem Hauptschuldigen." Dann fügte er hinzu: „Ich will nicht Gutes über Eichmann sagen, aber er war die Ideale Besetzung.“ Es war das einzige Mal, dass in Israel die Todesstrafe verhängt und vollstreckt wurde. Der Prozess erregte 1961 nicht nur in aller Welt größte Aufmerksamkeit, er war von fundamentaler Bedeutung für den neuen Staat. Der Kurator rief sie lebhaft in Erinnerung. Eine Million Überlebende der Shoah kamen nach Israel, wo zuvor 650000 Menschen lebten. Sie sprachen nicht über das, was sie erlebt hatten. Niemand mochte glauben, dass solche Gräueltaten möglich waren. Mit dem Prozess, in dessen Verlauf zuerst 112 Zeugen befragt wurden, änderte sich das gesellschaftliche Bewusstsein radikal. Nun konnte das Unsagbare ausgesprochen werden. Der Anklagte erhielt derweil Fanpost. Auch das ist in Potsdam zu sehen.

.jpg)


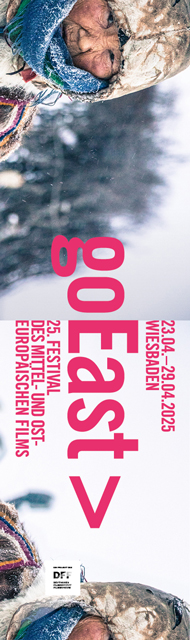
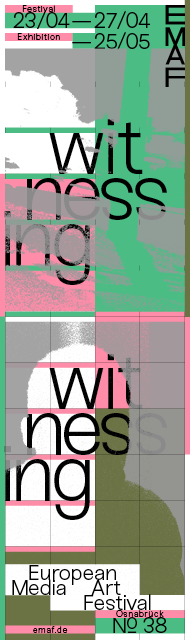

Ihre Meinung ist gefragt, Schreiben Sie uns